Wie Umfragen unseren Denkhorizont beschränken
Bei den US-Wahlen lagen Umfragen und Prognosen erneut weit daneben. Doch das ist nur der geringste Grund, warum wir aufhören sollten, Umfragen Glauben zu schenken. Sie schaden der Demokratie und hemmen den gesellschaftlichen Fortschritt. Ein Plädoyer.
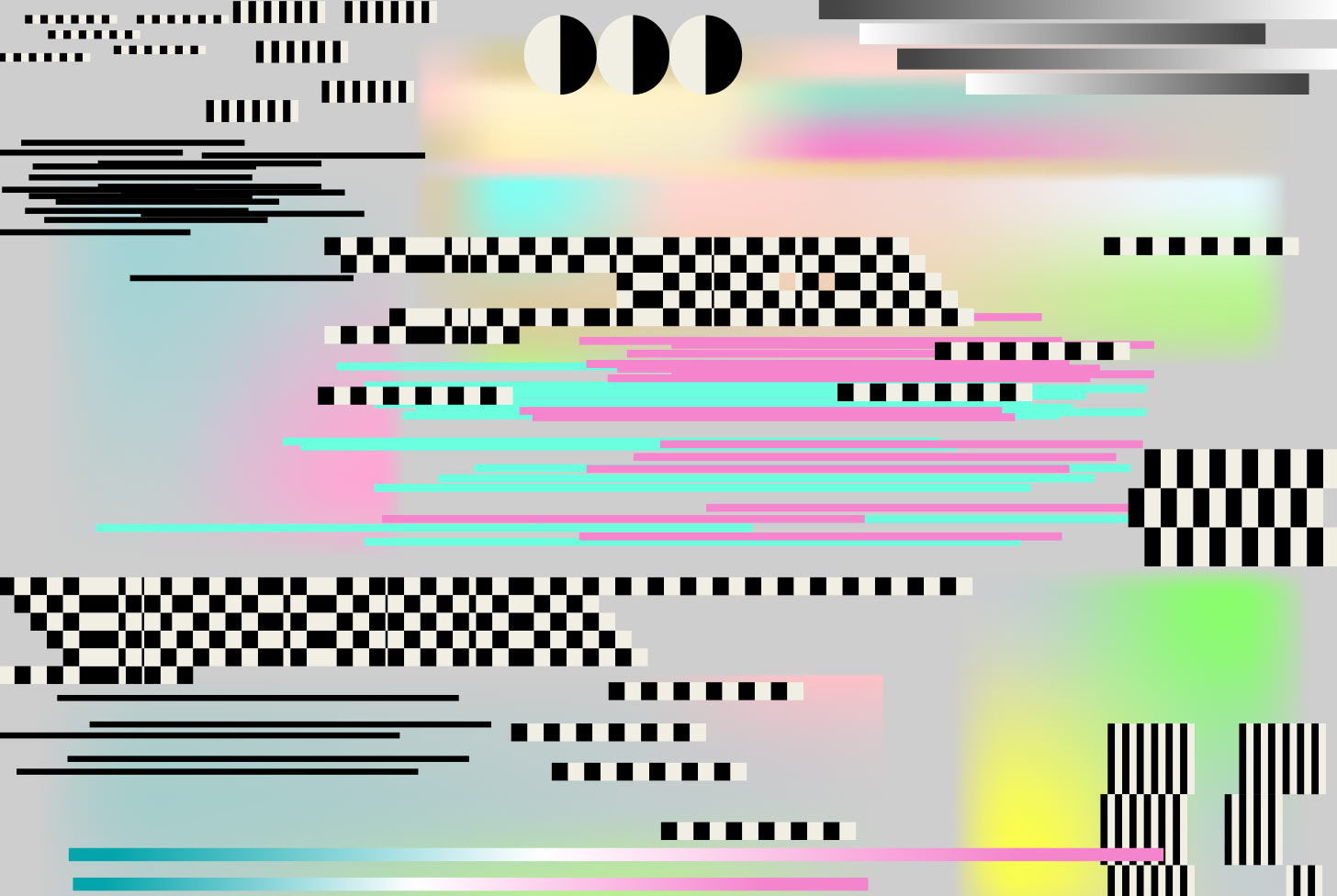
Joe Biden besiegt Donald Trump klar und deutlich mit grossem Vorsprung, vielleicht sogar in einem überwältigenden Erdrutschsieg. Die Demokraten bauen auch ihren Vorsprung im Repräsentantenhaus mit Sitzgewinnen im zweistelligen Bereich aus. Und sie erobern sich auch die Mehrheit im Senat zurück. Die US-Wahlen von 2020 sind eine blaue Welle.
Das sagten praktisch alle Umfragen voraus. Selbst aggregierte Umfrage-Modelle, wie sie beispielsweise «FiveThirtyEight», die «New York Times» oder der «Economist» aufstellten, kamen zum gleichen Schluss. Und alle hatten sie Unrecht: Bidens Sieg war sehr knapp, die Demokraten haben Sitze im Repräsentantenhaus verloren und im Senat bisher noch keine Mehrheit.
Die Prognosen zu den US-Wahlen lagen abermals daneben, und zwar noch deutlicher als 2016. Das hat in den USA eine Grundsatzdebatte über Sinn und Unsinn von Umfragen losgetreten. Auch Umfragegrössen wie Nate Cohn von der «New York Times» oder Andrew Gelman, Statistikprofessor und Kopf hinter den «Economist»-Prognosen, zeigen sich nach dem 2020-Fiasko sehr selbstkritisch.
Eine solche Debatte ist auch dringend bei uns in Europa und der Schweiz nötig. Auch wir sind besessen von Umfragen vor Wahlen und Abstimmungen und können uns Politik ohne das ritualisierte Orakeln über Umfrageergebnisse kaum vorstellen. Doch es gibt triftige Gründe, warum es ein Gewinn für unsere politische Kultur wäre, wenn wir gänzlich aufhören, Umfragen durchzuführen.
1. Ein realistisches Abbild der Bevölkerung wird immer schwieriger
Vor einigen Jahrzehnten befanden wir uns im goldenen Zeitalter der Umfragen. Ein Umfrageunternehmen konnte damals recht einfach Telefonnummern auswählen und Menschen zu Hause anrufen, die bereitwillig und ehrlich über ihre politischen Ansichten und Absichten Auskunft gaben. Weil die Auswahl an Leuten, die kontaktiert wurden, mehr oder weniger zufällig war, ergab sich in der Summe ein ganz nützliches Bild: Eine Zufallsstichprobe, die es in statistischer Hinsicht erlaubte, Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu machen. Dieses goldene Zeitalter ist aber längst hinter uns.
Unabhängig von der konkreten Methode, die eingesetzt wird (Telefonumfragen, briefliche Umfragen, Face-to-Face-Umfragen), sinkt in allen Ländern die Rücklaufquote massiv – immer weniger Menschen machen bei klassischen Umfragen mit. Das hat technologische Gründe (viele Menschen nutzen Festnetztelefonie nur noch selten oder gar nicht), aber auch soziale (viele Leute haben schlicht keine Zeit oder Lust auf Umfragen).
Viele Umfrageunternehmen werfen mittlerweile das Prinzip der Zufallsstichprobe komplett über Bord.
Als Konsequenz davon werden Stichproben immer verzerrter und zeigen damit ein weniger repräsentatives Abbild der Gesamtbevölkerung. Im Zusammenhang mit den Umfragen vor den US-Wahlen dürfte beispielsweise eine Rolle gespielt haben, dass eher konservativ eingestellte Leute grundsätzlich weniger an Umfragen teilnehmen, weil sie ihnen misstrauen. Um die mit dieser Ausfransung des Rücklaufs einhergehenden Fehler zu korrigieren, werden diverse Gewichtungsverfahren eingesetzt, die aus den vorhandenen Daten etwas basteln, das nahe an die Situation in der tatsächlichen Bevölkerung kommen soll.
Viele Umfrageunternehmen werfen mittlerweile das Prinzip der Zufallsstichprobe komplett über Bord und führen bequeme Online-Umfragen mit gänzlich verzerrten Stichproben durch, welche anschliessend mit komplizierten statistischen Verfahren «korrigiert» werden, um ein vermeintlich repräsentatives Bild zusammenzuschustern. Die Realität ist aber ganz einfach, dass Umfrageinstitute immer schlechtere Daten haben und in der Folge immer stärker im Dunkeln tappen – sie wissen gar nicht, was sie mit und in ihren Umfragen alles nicht wissen.
2. Umfragen beeinflussen die Wählerschaft
Hans will wählen, ist sich aber noch unsicher, welche Partei. In den Medien vernimmt er, dass neue Umfragen zeigen, Partei A liege in der Wählergunst vor Partei B. Beeinflusst die mediale Berichterstattung über Umfrageergebnisse, wie Hans wählt?
In einer perfekten Welt, in der wir alle strikt rational nach unseren aufrichtigen Präferenzen wählen, spielt es für Hans keine Rolle, wer in Umfragen die Nase vorne hat; er wählt gemäss seinen Werten, Einstellungen und Zielen. Doch die Realität will sich hartnäckig nicht an diese Theorie halten. Es gibt Studien (viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele Studien), die zeigen, dass Umfragen und die Berichterstattung darüber einen starken Einfluss darauf haben, wie Wählerinnen und Wähler denken und entscheiden. Eine Art, wie das geschieht, ist der sogenannte Bandwagon-Effekt: Wenn Wählerinnen und Wähler den Eindruck erhalten, dass eine Partei oder eine Kandidatin schwächelt, sinkt ihre Präferenz für die Partei oder Kandidatin; wenn im Gegenteil berichtet wird, dass eine Partei oder Kandidatin beliebt oder im Aufwind ist, wird diese Partei oder Kandidatin attraktiver.
In einer gesunden Demokratie debattieren wir über Inhalte und Ideen und treffen auf dieser Grundlage möglichst wohlüberlegte Entscheidungen. Umfragen haben den gegenteiligen Effekt und tragen dazu bei, dass Politik zu einem im Grunde inhaltslosen Schönheitswettbewerb wird.
3. Umfragen schaffen Pseudo-Ereignisse
Frag nie einen Coiffeur, ob du einen Haarschnitt brauchst. Und frag nie ein Umfrageunternehmen, ob wir Umfragen brauchen. In beiden Fällen besteht ein offensichtlicher finanzieller Anreiz, die Dienstleistung so oft wie möglich zu verkaufen.
Das zentrale Problem bei profitorientierten Umfrageinstituten ist ihr symbiotisches Verhältnis mit Medienunternehmen, welche in einer bemerkenswerten Verwertungskette mündet. Die beiden wichtigsten Umfrage-Player in der Deutschschweiz sind Schweizer Radio und Fernsehen SRF und Tamedia auf der Medienseite und die Unternehmen gfs.bern und Sotomo auf der Seite der Umfrageinstitute. Vor jeder grösseren Wahl und Abstimmung geben SRF und Tamedia Umfragen in Auftrag, und punktuell werden wir auch mit ausserordentlichen Umfragen beglückt, wie etwa aktuell den SRF-Umfragen zum Befinden der Bevölkerung in Corona-Zeiten.
Die Umfrageergebnisse dienen den Redaktionen als Rohmaterial für allerlei Beiträge und Artikel.
Medienorganisationen sind damit ein wichtiges, vielleicht das wichtigste wirtschaftliche Standbein der Umfrageindustrie im Bereich der politischen Umfragen. Die betroffenen Medienhäuser ihrerseits ziehen aus den Umfragen auch einen grossen Nutzen: Die Umfrageergebnisse dienen den Redaktionen als Rohmaterial für allerlei Beiträge und Artikel auf all ihren Kanälen.
Die nie abebbende Welle an Umfragen ist für die Medienhäuser doppelt attraktiv: Einerseits bereitet die Berichterstattung auf der Basis von Umfragen verhältnismässig wenig Aufwand: ein paar Zahlen, dazu ein paar Binsenweisheiten zur Erklärung der Ergebnisse, und fertig ist die Story. Andererseits lässt sich mit Umfrageergebnissen – so «billig» sie als journalistisches Format auch sein mögen – sehr gut Aufmerksamkeit generieren. «Horse Race»-Berichterstattung, also Journalismus, bei dem der blosse Wettbewerb zwischen Personen oder politischen Lagern im Vordergrund steht, zieht im Grunde immer, weil die Dramaturgie mit den emotionalisierenden Elementen von Sieg und Niederlage eine enorme Zugkraft hat.
Umfragen sind Pseudo-Events: Ein Konstrukt, das im Grunde nur heisse Luft generiert.
Der Historiker Daniel J. Boorstin hat in seinem Klassiker «The Image: A Guide to Pseudo-Events in America» kritisiert, dass Medien immer häufiger nicht bloss über reale gesellschaftliche Ereignisse berichten, sondern selber Pseudo-Ereignisse herstellen, um diese dann zu Geschichten zu machen. Frei nach dem Motto: «From news-gathering to news-making». Umfragen sind das perfekte Beispiel für solche Pseudo-Events: Ein Konstrukt, das im Grunde nur heisse Luft generiert, sich aber wunderbar zu Schlagzeilen machen lässt.
Der Verbund von Umfrageindustrie und Medien schafft dabei einen bemerkenswerten Kreislauf an Pseudo-Ereignissen. Politische Umfragen existieren zu einem guten Stück, weil Medien solche Umfragen in Auftrag geben. Medienhäuser ihrerseits münzen Umfrageergebnisse ihrerseits zu Geschichten um, die ihnen Aufmerksamkeit und Geld bringen. Das Besondere an dieser Symbiose ist, dass die Leute, die die Umfragen durchführen, in den Geschichten über die Umfragen als «Expertinnen» und «Experten» auftreten, um die Ergebnisse zu erklären und damit der ganzen Angelegenheit einen Hauch von Legitimität zu verleihen. Und weil das alles so wichtig ist – das sagen schliesslich Expertinnen und Experten! –, müssen natürlich auch in Zukunft Umfragen durchgeführt werden. Die Spirale der Pseudo-Ereignisse dreht weiter, ad infinitum.
4. Umfragen verengen den Raum des politisch Denkbaren
Demokratische Politik bedeutet, dass wir als Gesellschaft über Ideen und Probleme offen und kritisch debattieren. Dazu gehören auch Ideen, die heute vielleicht verrückt klingen mögen, weil sie stark abweichen von den uns bekannten Institutionen und Prinzipien. Doch Fortschritt kann es nur geben, wenn wir uns als Gesellschaft trauen, kritisch zu fragen, wo wir rationalerweise hinwollen.
Heute erodiert dieses aufrichtige Streben nach Fortschritt und Verbesserung, auch wegen der Umfrageindustrie. Politik und Zivilgesellschaft orientieren sich immer stärker an der blossen politischen «Machbarkeit» anstatt an philosophischen und moralischen Idealen. Das, was sich nicht zuletzt in Umfragen als mehrheitstauglich erweist, ist immer öfter der Weg, den die Politik wählt. Das presst das politische Leben in ein enges Korsett, das die Luft zum weitreichenden politischen Denken abschnürt.
Im politischen Diskurs stehen heute «Machbarkeit», «Realisierbarkeit» und «Wählbarkeit» im Vordergrund und nicht politische Ideale.
Die politischen Kommentatoren und Podcaster Nima Shirazi und Adam Johnson beschreiben dieses Problem als «Pundit Brain» (auf Deutsch so viel wie «Experten-Hirn»). Pundit Brain bedeutet, dass im politischen Diskurs und vor allem bei den etablierten politischen Parteien heute die «Machbarkeit», «Realisierbarkeit» und «Wählbarkeit» von Ideen und Personen im Vordergrund steht, nicht politische Ideale. Folglich orientiert sich dieser Diskurs an der vermeintlichen Mehrheitsmeinung. Die Umfrageindustrie und die damit verbundene Illusion, zu verstehen, was die Bevölkerung will und akzeptiert, sind die Grundlagen von Pundit Brain.
Pundit Brain ist doppelt tragisch. Einerseits hat Pundit Brain dazu geführt, dass sich viele Parteien in einem Status-Quo-Einheitsbrei aufgelöst haben. Das betrifft vor allem einen Teil der sozialdemokratischen Parteien, massgeblich Labour in Grossbritannien, die spätestens mit der neoliberalen Wende des «Dritten Weges» der 1990er Jahre ihren Kampf für die Arbeiterschaft mehr oder weniger aufgegeben haben und nun entsprechend orientierungslos vor sich hindümpeln.
Es fehlen Anreize und Kritik, die aufzeigen, in welche Richtung wir uns entwickeln können und sollen.
Andererseits und viel wichtiger ist der Umstand, dass durch Pundit Brain vergessen geht, dass die öffentliche Meinung eben von irgendwoher kommt. Menschen sind vernunftbegabt und lassen sich von guten Argumenten überzeugen. Was heute ein «unrealistisches» Ideal einiger weniger Leute ist, kann schon morgen zur breit abgestützten Mehrheitsmeinung werden. Die öffentliche Meinung ist dynamisch ist und entwickelt sich stetig. Pundit Brain ignoriert das. Der Fokus liegt stattdessen komplett auf der Momentaufnahme des Status Quo, wodurch Politik zu einer verknöcherten Angelegenheit wird: Ideen und Forderungen werden auf die vermeintliche Mehrheitsmeinung des Status Quo zugeschnitten, und die Gesellschaft bleibt letztlich im Status Quo der bestehenden Ideen und Ansichten verfangen. Es fehlen Anreize und Kritik, die aufzeigen, in welche Richtung wir uns entwickeln können und sollen. Das führt zu gesellschaftlichem Stillstand.
Fazit: Unsere politische Kultur kann nur gewinnen, wenn die Umfrageindustrie verschwindet
Es ist nur allzu menschlich, dass wir an politischen Umfragen hängen, wie an Prognosen überhaupt. Es gibt nichts Unangenehmeres als Ungewissheit – wir wollen schon heute wissen, was morgen passiert, und zwar besonders dann, wenn es um wichtige Entscheidungen und Entwicklungen geht. Umfragen können auch ein Stück weit gewisse politische Diskussionen versachlichen. Schliesslich gibt es keine politische Partei, die nicht für sich in Anspruch nicht, die Stimme der Mehrheit der Bevölkerung zu sein. Umfragen als ungefähre Schnappschüsse der breiten Gemütslage können ein Anzeichen für die ach so schwer fassbare «öffentliche Meinung» sein.
Doch der Nutzen von Umfragen ist weitaus geringer als ihr Schaden. Unsere politische Kultur wäre ziemlich sicher ein Stück weit offener, wilder, ideenreicher, würden wir nicht so an den Lippen der Umfrage-Auguren hängen. In einer Welt, in der wir nicht darauf konditioniert sind, gut zu finden, was eine vermeintliche Mehrheit in Umfragen gut findet, hätten wir viel mehr intellektuelle Freiheit, uns stärker mit Inhalten und Argumenten zu beschäftigen; auch dann, wenn diese auf den ersten Blick weit hergeholt wirken mögen. Politische Partizipation würde in einer umfragefreien Welt nicht mehr bloss ein nie endendes Wettrennen bedeuten, sondern viel stärker das Ideal eines kooperativen Wettbewerbs um bessere Ideen verkörpern.
Können wir diese fiktive Welt zur Realität machen? Können wir unseren öffentlichen Diskurs vom Fluch der Umfrageindustrie befreien? Umfragen grundsätzlich los zu werden, dürfte zumindest kurzfristig ein kaum realisierbares Vorhaben sein, weil Medienorganisationen sehr grosse Anreize haben, an Umfragen festzuhalten – Umfrageergebnisse sind für die Medienbranche köstliche Pseudo-Ereignisse, die sich einfach und wirkungsvoll verwerten lassen.
Ganz machtlos sind wir aber nicht. Der wohl einfachste Weg, um den Teufelskreis der nie endenden Umfragen zu brechen, ist, sie zu ignorieren. Also das nächste Mal, wenn über die neuesten Umfrageergebnisse berichtet wird, nicht zu klicken, nicht zu lesen, nicht zuzuschauen, nicht zuzuhören. Umfragen sind nämlich wie Gespenster: Wenn wir aufhören, an sie zu glauben, endet der Spuk.



Emil Annen 18. November 2020, 10:02
Zwei grundsätzliche Fehler im Umgang mit Marktforschungsergebnissen: Streubereich vernachlässigen und Daten mit den eigenen Interpretationen vermischen. Wenn der Mensch Zahlen sieht, beginnt er diese sofort mit seinen eigenen Erfahrungen und seinem Wissen zu interpretieren und meint, seine sich daraus ergebende Meinung mit wäre die Realität, denn die Zahlen, die Fakten zeigen dies ja deutlich. Einer der häufigsten Fehler, auch bei Journalisten und Autoren.
Mehr dazu unter: https://www.nzz.ch/international/wahlen-usa-2020/nicht-die-umfragewerte-lagen-daneben-sondern-deren-interpretation-ld.1585242?reduced=true
Marko Kovic 18. November 2020, 12:06
Grüezi Herr Annen
Merci für den Kommentar! Mir scheint aber, dass Sie nicht wirklich auf die Argumente im Text eingehen.
Zu Ihren Punkten:
1) Streubereich vernachlässigen
– Zu bemerken, dass es „Streubereiche“ (Konfidenzintervalle, Kredibilitätsintervalle, Highest Density Intervals, etc.) gibt, ist ja trivial. Das Problem an Umfragen ist *nicht*, dass Leute Ungewissheit statistischer Modelle missverstehen.
2) Daten und eigene Interpretationen
– Dieses Argument verstehe ich wahrscheinlich nicht richtig. M.e. muss man Daten selbstverständlich interpretieren und kritisch einordnen.
Das verstehe ich auch nicht ganz. Umfragen erheben ja den Anspruch, etwas mit der Realität zu tun zu haben? Es ist darum m.E. gerade kein „Fehler“, wenn Leute, die nicht „vom Fach“ sind, diesen Anspruch ernst nehmen. Aber vielleicht missverstehe ich, worauf Sie hinaus wollen – wir denken vielleicht aneinander vorbei.
Zum NZZ-Artikel: Das ist einfach die altbekannte Rechtfertigungsstrategie – doch die Behauptung, dass das Problem bloss die Interpretation ist, ist schlicht falsch. In den USA lagen die Umfragen und die aggrehierten Modelle 2020 stärker daneben als 2016. Vgl. die Links zur Debatte in den USA. Aber wie im Artikel vermerkt: Die mangelnde Genauigkeit und Präzision von Umfragen ist noch deren geringstes Problem.
Mit bestem Gruss
Marko Kovic
Emil Annen 18. November 2020, 17:15
Grüezi Herr Kovic
Vielen Dank für ihre schnelle und ausführliche Reaktion.
Das Problem ist, dass Umfrageergebnisse eben „nur etwas“ mit der Realität zu tun haben, aber nicht die Realität sind. Die liegt irgendwo in der näheren oder weiteren Umgebung dieser Ergebnisse, meistens innerhalb des Vertrauensbereichs. Dem entsprechend muss man dessen bewusst sind und vorsichtig mit den Ergebnissen umgehen.
Wenn die Ergebnisse so nahe beieinander in der Nähe von 50% liegen wie in den USA, ist der Vertrauensbereich am grössten. Dann liegen die Ergebnisse zwar in der Nähe der Realität, können letztlich diese aber nicht abbilden und werden je nach dem realen Ergebnis als falsch wahrgenommen.
Zur Interpretation von Zahlen, Menschen ziehen sofort aus Zahlen ihre Schlüsse, verbinden diese mit ihren Erfahrungen und weiterem Wissen und sind sich dessen nicht bewusst. Menschen können schwer unterscheiden zwischen dem was Zahlen sind und dem, was sie selbst mit diesen Zahlen verbinden und damit hinein interpretieren. Das führt dann zur Meinung, man argumentiere mit Zahlen und Fakten und merkt nicht, dass die eigenen Interpretationen im Vordergrund stehen und allenfalls anderen Interpretationen gegenüber gestellt werden.
Mir geht es letztlich darum, dass man mit Zahlen vorsichtiger umgehen muss, als dies allgemein geschieht und dies nicht nur bei Umfragen oder auch in anderen Gebieten. Wenn man unterschiedliche Zahleninterpretationen als Ausgangslage den Argumentationsketten zu Grunde legt, können deren Ergebnisse sehr unterschiedlich sein. Dann diskutiert man über die Ergebnisse der Argumentationsketten und übersieht, dass schon die gedankliche Ausgangslage unterschiedlich war. Dies ist der Grund, warum ich Ihre Argumentationen an sich nicht in Frage stelle oder Stellung dazu nehme, sondern nur die Ausgangslage.
Ich muss dies alles noch auf soziale Situationen mit Menschen einschränken. In der Physik ist dies klarer und eindeutiger.
Noch einmal Dank, ihre Gedanken sind trotzdem spannend und in vielem kann ich Ihnen folgen und bin ihrer Meinung.
Emil Annen 18. November 2020, 17:48
Grüezi Herr Kovic
Ich habe einigen ihrer Zitate (kursiv) meine Meinung! Gegenüber gestellt.
«… geringste Grund, warum wir aufhören sollten, Umfragen Glauben zu schenken», einverstanden, aber an Umfragen soll man nicht glauben, denn sie sind eine Momentaufnahme irgendwo in der Nähe der Realität. «Das sagten praktisch alle Umfragen voraus.» Umfragen sind Momentaufnahmen und diese sind keine Voraussagen. Voraussage sind bereits Interpretationen, geprägt von Meinungen und auch Wünsche. «Selbst aggregierte Umfrage-Modelle … kamen zum gleichen Schluss. Und alle hatten sie Unrecht». Das liegt aber nicht an den Umfragen, sondern an den Modellen, die mit den Umfrageergebnissen arbeiten. Modelle sind immer grobe Abbilder der Realität mit Lücken und Fehlern, geprägt von den Meinungen und Einstellungen derjenigen, welche die Modelle erarbeiten.
«Auch Umfragegrössen wie Nate Cohn von der «New York Times» oder Andrew Gelman, Statistikprofessor und Kopf hinter den «Economist»-Prognosen, zeigen sich nach dem 2020-Fiasko sehr selbstkritisch» Ich vermute, weil sie sich der Mängel bewusst sind. Hätten sie recht gehabt, hätte kein Hahn danach gekräht. Interpretationen und Folgerungen aus Umfrageergebnissen sind schon fast eine Lotterie, vor allem, wenn die Aussagen zu wenig vorsichtig gemacht werden. Aber solch vorsichtig Aussagen möchte ja niemand hören. Menschen streben nach Sicherheit und vorsichtige Aussagen können diese nicht geben und sind darum nicht gefragt. Die Folge davon «Auch wir sind besessen von Umfragen vor Wahlen und Abstimmungen und können uns Politik ohne das ritualisierte Orakeln über Umfrageergebnisse kaum vorstellen.» Das ist schon fast wie Weihnachten, wenn Kinder rätseln, was wohl unter dem Christbaum liegen wird.
«Eine solche Debatte ist auch dringend bei uns in Europa und der Schweiz nötig.»- Genau, völlig einverstanden und diese Debatte fängt schon bei der Interpretation der Zahlen und Umfrageergebnisse an und nicht erst bei den Folgen.
«Doch es gibt triftige Gründe, warum es ein Gewinn für unsere politische Kultur wäre, wenn wir gänzlich aufhören, Umfragen durchzuführen.» Da bin ich nicht einverstanden, das wäre das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Genau das hat mich gestört. Ein anderer, differenzierter Umgang wäre sinnvoll, der das ganze System berücksichtigt.
Damit sind aber noch nicht die Fehler aufgegriffen, welche in jeder Umfrage vorhanden sind, wie z.B. die Diskussionen über die Repräsentativität, welche mehr oder weniger die Umfrageergebnisse von der Realität noch weiter wegdrücken. Aber das wäre ein anderes, weiteres Diskussionsthema.
Emil Annen 18. November 2020, 18:11
Grüezi Herr Kovic
Ich lege noch etwas nach. Mit Ihrer Kritik an den Umfragen bin ich völlig einverstanden und setze noch eins oben drauf. Vielfach werden von den Befragten sozial erwünschte Antworten gegeben, also solche, von denen man meint, sie wären bei den meisten Menschen vorhanden, die aber möglicherweise der eigenen Meinung entgegengesetzt sind. Auch die Reihenfolge der Frage und ihre Formulierung kann die Ergebnisse beeinflussen. Das Zurechtrücken der Ergebnisse in eine vermeintliche Repräsentativität ist schon seit Jahrzehnten ein Thema. Dafür müsste man in der Grundgesamtheit die Verteilung der Eigenschaften kennen, welche einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte, aber die kennt man nie alle. Da wird dann der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
Mit Ihrer Aussage «Unsere politische Kultur kann nur gewinnen, wenn die Umfrageindustrie verschwindet» bin ich ganz und gar nicht einverstanden. Die politische Kultur kann gewinnen, wenn ein besserer, kritischerer Umgang mit den Umfrageergebnissen gepflegt wird. Wenn sich die Leute bewusst sind, wo die Aussage der Ergebnisse aufhört und wo die eigene Interpretation durch eigene Meinung und auch durch Wünsche und Vorstellungen beginnt.
Dies trifft nicht nur auf das politische Geschehen zu, sondern auch auf die Wirtschaft und sogar auf Forschungen, in denen mit Umfragen gearbeitet wird, z.B. in der psychologischen oder soziologischen Forschung. Ohne Umfragen sind wir blind, mit Umfragen sehen wir die Welt verschleiert und verzerrt, niemand weiss, wie stark verschleiert und verzerrt, aber immerhin sehen wir etwas und da beginnt bereits wieder die Interpretation.
Achmed Bitzius 22. November 2020, 23:00
Sehr interessanter, aber auch trauriger Kommentar. – Vielleicht sollten sich – in der Schweiz – die Umfrageexperten einmal auch mit Voraussagen rund um das Verständnis von Volksinitiativen befassen: „Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten“, „Begrenzungsinitiative“, etc. Wenn die Nationalbank Aktien der Rüstungsindustrie kauft, profitiert sie resp. die Bevölkerung vor allem davon (unabhängig von der Moral); wenn die SVP von „Begrenzung“ spricht, meint sie die Abschaffung der Bilateralen. Es wäre interessant, von den Experten zu erfahren, wie lange es geht, bis das Gros der Stimmenden wirklich begreift, was eine Volksinitiative wirklich bezweckt, wenn die Bezeichnungen der Initianten erst einmal durch die Medien „transparent gemacht“, „verkürzt“ und „richtig gebogen“ werden müssen, damit der Zweck erkenntlich wird. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass viele Initiativen zuerst einmal deutlich im Plus der Meinungsumfragen liegen, um dann mit der Zeit, wenn endlich klar wird, was wirklich bezweckt wird, ins Minus zu fallen. Als Stimmende hätten wir vielleicht ein Anrecht (politisches Menschenrecht!?) darauf, dass Volksinitiativen objektiv betitelt werden, anstatt Suggestivbezeichnungen zu erhalten.