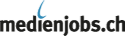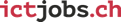Tamedia und Keystone-SDA forcieren den Roboter-Journalismus
Das Bewerbungsschreiben der Roboter-Journalisten: Bei Tamedia kommt Textroboter «Tobi» beim anstehenden Abstimmungssonntag erstmals schweizweit zum Einsatz und wird die Resultate aller 2’222 Gemeinden des Landes abdecken.