NZZ-Qualität aus Banja Luka
Die NZZ-Regionalzeitungen «St. Galler Tagblatt» und «Luzerner Zeitung» lassen ihre Artikel künftig in Banja Luka (Bosnien) korrekturlesen. Ein äusserst gewagtes Experiment, das der Qualität der Zeitungen schaden könnte, findet Markus Schütz. Denn Sprache ist immer lokal geprägt. Der langjährige Korrektor («Bund», «Beobachter») analysiert Chancen und Risiken des Outsourcings.
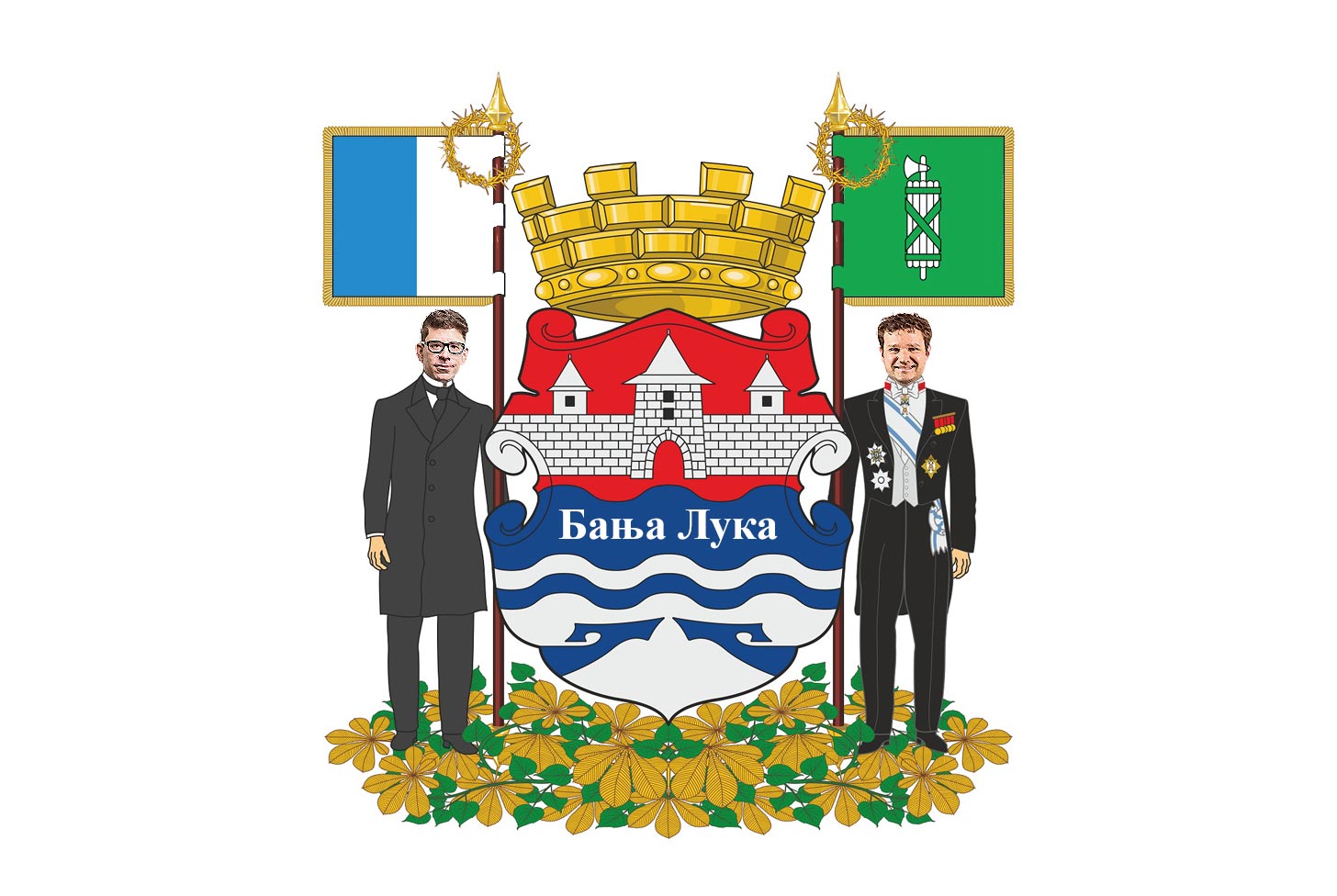
Als Spracharbeiter bedauert man hin und wieder, nie was Anständiges gelernt zu haben, das einem die Mobilität über den Sprachraum hinaus erlaubt. Im Gegenzug konnte man sich bisher einigermassen sicher wähnen, nicht durch ausgebeutete Billigkonkurrenz in Indien ersetzt zu werden. Bisher. Die NZZ-Regionalmedien machen nun den Anfang und lagern das Korrektorat nach Bosnien-Herzegowina aus. Die Firma Tool-e-Byte machts laut Website für 13.50 Euro die Stunde in Banja Luka; Ableger in Peru und Indien sollen folgen.
Gegen ein räumliches Outsourcing des Korrektorats ist zunächst nichts einzuwenden – es gibt je länger, je weniger Gründe, wieso man mit den entsprechenden Skills den Job nicht auch räumlich getrennt vom Rest der Redaktion ausführen könnte. Ich habe es selbst während eines Jahres als Korrektor für die Berner Tageszeitung «Der Bund» in Berlin ausprobiert – dabei aber auch gemerkt, wie wichtig die physische Nähe zur Redaktion halt immer noch ist. Man geht eben schnell mal zur Layouterin rüber, pröbelt an der Bildlegende rum, bis sie endlich zusammen mit dem Namen des Bildautors auf eine Zeile passt, schiebt das Zitat rum, bis das Hurenkind verschwindet, oder man findet den Journalisten, von dem man unbedingt noch eine fehlende Angabe braucht und den man telefonisch nicht erreicht, draussen auf der Terrasse beim Rauchen oder unten beim Döner. Oder man schaut aus dem Fenster, um zu wissen, dass noch der Wetterbericht von gestern im Satz geblieben ist.
Ein gutes Korrektorat leistet auch Faktenprüfung. Das kann nur schlecht ausgesourct werden.
Die reine Rechtschreibeprüfung kann man irgendwo auf der Welt durchführen. Schwieriger outzusourcen ist dagegen die Faktenprüfung, die ein gutes Korrektorat als Beitrag zur Qualitätskontrolle leistet, zumal bei Texten über das lokale Geschehen, zu dem die Korrektorin in Bosnien nicht den geringsten Bezug hat. Als Korrektor am «Bund» musste ich zum Beispiel erkennen, ob das Bild eine Sitzung des Grossen Rats oder nicht doch des Stadtrats von Bern zeigt, die beide im gleichen Saal im Berner Rathaus tagen. Auch sollte man wissen, dass der Journalist mit «Eglisee» wohl eher den Berner Egelsee gemeint hat.
Dabei geht es nota bene um die Prüfung von Texten, die zuvor bereits mehrere RedaktorInnen gelesen haben. Man muss doch die lokalen Gegebenheiten, wie Sportclubs, Parteien, Museen, ebenso wie die A-, B- und C-Prominenz, die politischen Institutionen und Gremien einigermassen kennen, um zu merken, wenn ihnen etwas zugeschrieben wird, was nicht stimmen kann. Dass es bei den NZZ-Regionalmedien heisst, dass in Bosnien nur die Regionalseiten, nicht aber der Mantel gelesen werden, tröstet da nur wenig – Donald Trump kennt man in Bosnien so gut wie in Bern. Nicht aber Eric Hess. Oder heisst er Erich?
In Redaktionen und Verlagen fängt die Arbeit an ihrer eigenen Sprache dort an, wo der Duden aufhört.
Sprache ist immer lokal geprägt. Das ist auch wichtig, gerade bei Lokalzeitungen: In der Sprache ist man der Leserschaft nahe. Das lässt sich nicht nach einem Kurs über die Eigenheiten des Schweizer Hochdeutschs simulieren. Ein Korrektorat bestimmt in gewissem Masse auch mit, in welcher Sprache, in welchem Sprach-Habitus eine Publikation zu ihren Leserinnen und Lesern spricht. Nicht alles lässt sich einfach mit den Duden-Empfehlungen über einen Leisten scheren: In Redaktionen und Verlagen fängt die Arbeit an ihrer eigenen Sprache dort an, wo der Duden aufhört. Das alles ist schwer quantifizierbar, es hat mit Stil zu tun, mit Unverwechselbarkeit – gerade im Haus NZZ muss man wissen, wie wichtig sprachliche Sorgfalt und Eigenständigkeit für das Produkt ist. Die NZZ setzt mit dem «Heuer» und ihrem «Vademecum» die Branchenstandards. Jeder beflissene Zeitungsleser kann Beispiele nennen für die Corporate-Identity-Sprachschrullen, die dem Blatt unter anderem ein Gesicht geben, sei es Plastic mit c oder Cis-Jordanien fürs Westjordanland.
Das Korrektorat outzusourcen ist zumindest gefährlich, vielleicht dumm, vielleicht ist es einfach pure Verzweiflung. Vermutlich hat aber jemand aus dem Verlag, der in seinem Geschäftsprozess-Diagramm irgendwo den Prozessschritt «Korrektorat» gesehen und mit einer Frankenzahl versehen hat, diesen Schritt gehörig unterschätzt. Es geht hier um Deutschkenntnisse auf einem sehr abstrakten, sehr artifiziellen Niveau. Es ist keineswegs so, dass einem ein Germanistikstudium bereits ausreichend zur Arbeit im Korrektorat qualifiziert. Bis zum guten Korrektor, zur guten Korrektorin gibts noch einiges zu lernen, es geht nicht nur um die Sprache, es geht zudem um Faktencheck und um gepflegten Schriftsatz. Deswegen wird die Berufsausbildung «Korrektor EFA» oft noch einem Studium angehängt. Es wären ja sonst nicht die Korrektoren, die die Dissertationen der GermanistInnen korrekturlesen würden…
Man hat also in Bosnien Personal zur Verfügung, das besser Deutsch kann als die muttersprachlichen Journalisten in der Schweiz.
Natürlich, es gibt im deutschen Sprachraum Regionen, in welchen die Produktion billiger ist. Ein Outsourcing nach Deutschland, in deutschsprachige Gebiete Rumäniens, vielleicht sogar nach Tschechien hätte weniger überrascht. Aber nach Bosnien? Es heisst, viele der Mitarbeiterinnen (wieso eigentlich nur Frauen?) seien «ehemalige Flüchtlinge, die während des Jugoslawienkrieges in deutschsprachigen Ländern Zuflucht gefunden hätten. Viele von ihnen hätten Germanistik studiert.» Man hat also in Bosnien Personal zur Verfügung, das besser Deutsch kann als die Muttersprachler, die sich beruflich schwergewichtig mit Sprache beschäftigen, was Journalistinnen und Journalisten ja tun. Dieses Personal ist darüber hinaus mit einigen kommunikativen Skills ausgestattet und skypt im Abschlussstress mit Produzent, Layout und Autorin, um eine Textstelle noch irgendwie so zu korrigieren, dass sie ins Blatt passt. Gut qualifizierte Leute also, Respekt – da müssen wir uns doch schämen, dass es uns nicht gelungen ist, diese Leute hierzubehalten.
Oder ist es einerlei, woher die Leute kommen und wo sie arbeiten? Es heisst ja in der Stellenausschreibung: «Falls Sie nicht in Banja Luka leben, können Sie diese Aufgaben auch von zu Hause aus durchführen.» Es sind also sicher auch die von der NZZ entlassenen KorrektorInnen herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Das riecht doch einfach nach Lohndrückerei.
Aber wieso macht man dann beim Korrektorat schon halt? Wieso übernimmt Bosnien nicht auch gleich einen Teil der Berichterstattung?
Aber machbar wäre es schon. Wenn denn wirklich gut qualifiziertes Personal gefunden und anständig bezahlt, wenn es auch gut für die Bedürfnisse der Zeitungsproduktion, des Verlagswesens ausgebildet wird und wenn die lokalen Gegebenheiten keine Rolle spielen, dann spricht tatsächlich nichts dagegen, dass man den Job in Banja Luka und nicht in St. Gallen ausführt. Aber wieso macht man dann beim Korrektorat schon halt? Wieso übernimmt man nicht gleich einen Teil der Berichterstattung? Journalisten, Journalistinnen, so klagt man, verlassen den Schreibtisch schon heute kaum mehr. Lohnt sich auch nicht mehr, Recherchieren steht eh synonym mit Googeln. Ein paar Pressestellen für eine Stellungnahme abtelefonieren kann man auch von Bosnien (oder irgendwo) aus, und weiter als bis zur Mediensprecherin kommt man auch in St. Gallen nicht. Die Voces populi zieht man aus Facebook und Twitter, Problem wo?
Die Branche insgesamt muss sich schämen. Die einen Verlage produzieren noch halbherzig Zeitungen und könnten bekanntlich genauso gut Katzenfutter verkaufen. Die anderen scheinen zwar noch irgendwie an den Journalismus zu glauben, übergeben aber die Produktion von dessen Seele – der Sprache – dem billigsten Anbieter auf dem globalisierten Markt. Die Verantwortlichen scheinen sich selbst nicht mehr bewusst zu sein, wie komplex das Medienerzeugnis ist, das sie verkaufen wollen, wie abhängig es ist von qualifiziertem Personal. Oder sie geben zu, dass sie zwar qualifiziertes Personal brauchen, aber nicht in der Lage sind, es anständig zu bezahlen.

Carlita 26. September 2017, 14:06
…sie sprechen oder besser schreiben mir aus der Seele….
Mario 26. September 2017, 16:40
sehr schön!
GgdK 26. September 2017, 23:25
Warum habe ich ich den Korrektoren-Fernkurs absolviert?
Um der GF der NZZ ein «Pfui» zu widmen?
Markus Schütz 27. September 2017, 09:27
Gegenfrage: Habe ich mich mit dem Kurs verpflichtet, fortan auf Kritik zu verzichten? Und: Wieso baut man mit diesem Kurs bewusst einen Berufsstand auf, wenn man ihn später für verzichtbar hält? Der Kurs und seine Inhalte sind doch Ausdruck einer ganz anderen Generation von Medienschaffen. Ich persönlich finde nicht, dass seine Inhalte obsolet sind, aber offenbar sind sie zu teuer.
Frank Hofmann 27. September 2017, 20:09
Möchte niemandem zu nahe treten, aber es gibt eben viele Zeitungskorrektoren und -korrektorinnen, die es sich sehr bequem eingerichtet haben. Man sollte auch mal etwas Ehrgeiz entwickeln und versuchen, von der Routinearbeit bei der Zeitung wegzukommen, und sich anderswo umschauen. Wer nicht sein ganzes Berufsleben im Zeitungskorrektorat verbringen möchte, für den ist der anspruchsvolle Korrektorenkurs sehr wertvoll, da er auch Fremdsprachen umfasst, und dies auf sehr hohem Niveau. Französisch und Englisch sind Mindestanforderungen, um für Werbe- und PR-Agenturen tätig zu sein. Italienisch ist ebenfalls sehr wichtig. Damit kann ein Korrektor in unserem Land Magazine und andere Drucksachen in mehreren Sprachen abdecken. Das ist ein enormer Vorteil und wird von den Agenturen auch verlangt. – Die Entwicklung bei den Zeitungen hat sich doch schon lange abgezeichnet mit der zunehmenden Digitalisierung und der damit einhergehenden Gratiskultur. Erstaunlich ist höchstens, dass ausgerechnet die NZZ mit dieser Massnahme die Sprache gering schätzt und aufs Discountkorrektorat setzt. Allerdings sehe ich in der Praxis grosse Hindernisse. Diese Übung wird höchstwahrscheinlich scheitern – die „Germanistinnen“ werden Stilübungen veranstalten und dabei die echten Fehler inkl. dicker Hunde übersehen. Das wird ärgerlich, hauptsächlich für die Redaktionen.
Marianne 27. September 2017, 08:54
Ich bin geschockt. Habe das schon letzte Woche rumoren gehört. Schlicht weg unverschämt. Wie weit wollen unsere Wirtschaftsbosse noch gehen, um unser Land vollständig an den Abgrund zu drängen? AHV-Killer und Systemzerstörer. Jammern über die hohen Löhne, die wir in unserem Land haben. Zum Leben in unserem Hochpreisland kann sich niemand von 13,50 Euroüber Wasser halten. Die Sozialwerke werden systematisch ausgehöhlt. Wenn ich dann mal nach Indien auswandere, bewerbe ich mich.
Jil Lüscher 27. September 2017, 11:42
Das ist in der Tat eine sehr bedenkliche Entwicklung, kann aber auch eine Chance sein für die lokalen Medien. Die bekommen ein Differenzierungsmerkmal gratis zugespielt, das sie noch näher zu den Menschen aus der Region bringen kann. Spannend wird sein, wie der Werbemarkt auf dieses kaum nachvollziehbare Outsourcing reagieren wird, zumal gerade die beiden Titel SG Tagblatt und Luzerner Zeitung in ihren Regionen stark verankert sind.
Jösu 27. September 2017, 15:08
interessanter Artikel, auch für jemanden Fachfremden wie mich. Apropos Faktencheck; die korrekte Bezeichnung des Staates, in dem Banja Luka liegt, wäre übrigend Bosnien und Herzegowina.
Christoph Egger 27. September 2017, 17:18
„Es ist keineswegs so, dass einem ein Germanistikstudium bereits ausreichend zur Arbeit im Korrektorat qualifiziert.“ Wohl wahr, aber möglicherweise hat man dort doch die Sache mit dem Akkusativ mitbekommen…
Christoph Egger, Zürich
Lahor jakrlin 28. September 2017, 10:07
Es besteht kein Zweifel, dass es in Bosnien noch und nöcher Menschen gibt, die perfekt Deutsch sprechen. Wer auf dem Fundament der slawischen Sprachen (7 statt 4 Fälle) von klein auf Deutsch lernt, ist den helvetischen MitschülerInnen bald ein paar Längen voraus.
Aber ein Korrektorat zur lokalen Berichterstattung in Schweizer Regionen in Bosnien durchführen zulassen, ist Bullshit – der Autor hat alle Argumente aufgeführt. Inklusive das Unvermögen, das Layout zu beeinflussen.
Es geht um ein Outsourcingbeispiel der tiefsten Güteklasse.
Richard Scholl 28. September 2017, 16:33
Nur schon Ihre Forderung: „…kann ja nicht outgesourct werden“ zeigt, wo es hapert: unser Medienschaffenden beherrschen weder die deutsche noch die englische Sprache, meinen aber, mit dem Mischen der beiden Sprachen Sympathien bei ihren Lesern zu erwirken.
Nick Lüthi 28. September 2017, 16:46
Kennen Sie den Duden? Dort steht auch das Verb „outsourcen“.
Heinrich Frei 29. September 2017, 21:24
Als ich dies gelesen habe, dass die Korrektur nach Bosnien- Herzogewina ausgelagert wird, dachte ich an einen guten Witz des Tages Anzeigers, à la Frenkel.
Kurt Murpf 30. September 2017, 09:43
Entscheidende Kriterien für den Erwerb einer Ware sind für mich als Konsument die Herkunft, die Produktionsweise, der Qualitätsstandard und besonders die Arbeits- und Lohnbedingungen der Angestellten. Sind diesbezüglich Mängel oder gar Verfehlungen auszumachen, wähle ich ein anderes Produkt.
Vor diesem Entscheid stehe ich, wenn ein elementarer Teil der Zeitungsproduktion, das Korrektorat, von der NZZ (Ablegern) in Billiglohnländer ausgelagert wird. Jede Entwicklung in diese Richtung der Gewinnoptimierung macht den Entscheid leichter und zwingender.