Serie 20 Jahre «20 Minuten», Teil 1: War einmal ein Maoist in der Journalistenschule
«Metro» war die erste Pendlerzeitung. Von Stockholm aus eroberte sie in den 1990er-Jahren die Welt. Der Erfolg der Gratiszeitungen basierte auf einer einfachen buchhalterischen Überlegung, die ein schwedischer Journalistenschüler 1973 aufschnappte und zwei Jahrzehnte später in die Praxis umsetzte. – 20 Jahre «20 Minuten», Teil 1. (Teil 2 und Teil 3)
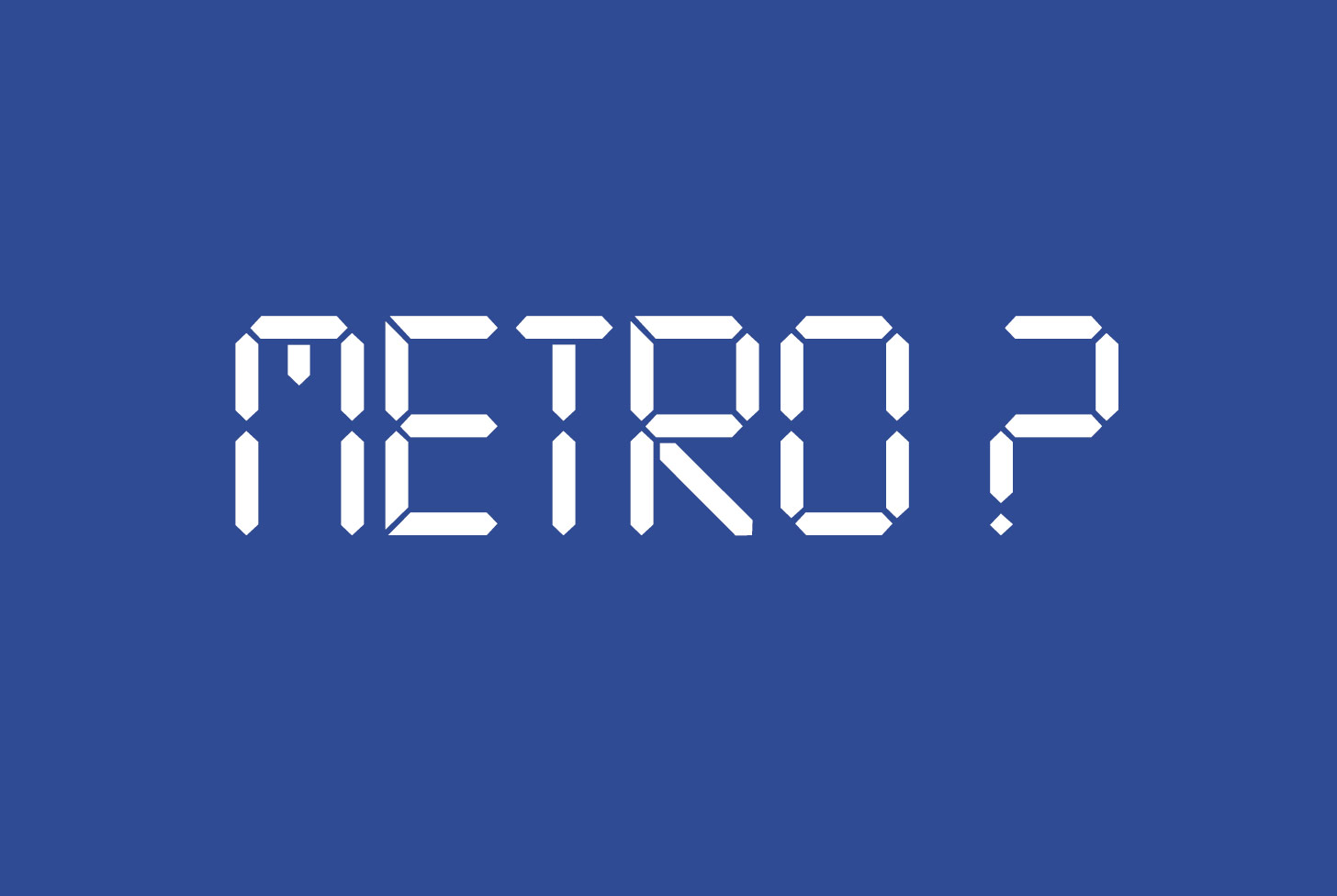
Der überraschende Blitzstart ging in die Hose. Am Montag, dem 13. Dezember 1999 standen in Zürich am Bellevue, am Paradeplatz, am Central und im Bahnhof Stadelhofen die frisch eingekleideten Verteiler bereit – aber Zeitungen hatten sie keine. Erst gegen 8.30 Uhr traf der verspätete Transport aus der Druckerei in Österreich ein. Die Produktionsverspätung der Redaktion vom Vorabend und der morgendliche Stossverkehr auf der Autobahn hatten dem neuen Gratisblatt den Start vermasselt. Dennoch zeigte sich bald, dass «20 Minuten» einer der grössten verlegerischen Erfolge in der Schweizer Pressegeschichte sein würde.
Die direkt angegriffenen Zürcher Tageszeitungen schlugen zum Empfang des neuen Gratis-Konkurrenz gar freundliche Töne an.
Merkwürdig war, dass die eingesessene Schweizer Zeitungsbranche den Eindringling aus Skandinavien mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und Herablassung empfing. Ganz anders in Köln, wo «20 Minuten» am gleichen Tag startete. Während dort Springer, Du Mont und andere Zeitungsverlage Kampfgründungen aus dem Boden stampften und zugleich mit allen juristischen Waffen auf die Neuankömmlinge schossen, blieb der Schweizer Verlegerverband passiv.
Verbandspräsident der Verleger war damals Hans Heinrich Coninx, Verwaltungsratspräsident des Tages-Anzeigers. Die direkt angegriffenen Zürcher Tageszeitungen schlugen zum Empfang des neuen Kollegen gar freundliche Töne an. Die NZZ spendete vergiftetes Lob: Die Erstausgabe lasse sich durchaus sehen; man habe sie «schnell zur Hand und werfe sie ebenso leicht und schnell wieder fort.»
Vorübergehend wurde Zürich zum Kampfplatz der Gratiszeitungen die ihren Ursprung in Skandinavien hatten, genauer: 1973 in einer Lektion über Zeitungswirtschaft an der Stockholmer Journalistenhochschule. «Woher kriegen die Zeitungsverlage eigentlich ihr Geld?», fragte der Dozent. «Von den Abonnenten», antwortete einer der Studenten. «Richtig, von da kommt etwa ein Drittel. Und der Rest?» Es muss ein ziemlich langweiliger Morgen gewesen sein im Stockholmer Journalistenkolleg. Der Dozent zeigte ihnen, dass allein der Vertrieb der abonnierten Zeitung ebenso viel kostet, wie die Abonnemente einbringen, nämlich einen Drittel des Budgets. Da sagte einer aus der Klasse: «Wenn das stimmt, könnte man ja die Zeitung auch verschenken, vorausgesetzt, man brächte die Leser dazu, sie abzuholen!»
Gratis-U-Bahn, Gratiszeitung – wenn man das zusammenbringen könnte!
Das war die Geburt der «Metro»-Idee. Pelle Anderson, der in der Klasse sass, war damals 19 Jahre alt und überzeugter Maoist. Es war die Zeit der grossen linken Kampagnen für den öffentlichen Verkehr zum Nulltarif. Anderson war elektrisiert. Gratis-U-Bahn, Gratiszeitung – wenn man das zusammenbringen könnte!
Die Idee verschwand wieder. Aber sie war nicht tot, sie schlief nur. Zusammen mit Monica Lindstedt und Robert Braunerhielm, zwei Mitschülern aus der damaligen Klasse, entwickelte Anderson aus der Gratiszeitungsidee einen Businessplan. Aber die schwedischen Verleger wollten zunächst nichts davon wissen.
Nach vielen Absagen von Banken und Verlagen fand sich 1994 mit Jan Stenbeck ein Investor für das «Metro»-Projekt. Der galt damals als der wilde Hund unter den schwedischen Unternehmern. Er hatte die alteingesessene Investmentgesellschaft Kinnevik von der Zellstoff- und Papierbranche auf die Medien- und Telekom-Industrie umgepolt. Stenbeck hatte Vodafone mitgegründet, später half er dem Billigmobilfunkanbieter Tele 2 auf die Beine. Und er war es, der in Schweden das Privatfernsehen durchsetzte und in einem Höllentempo ganz Skandinavien, die baltischen Staaten und bald auch das geöffnete Russland mit Sendern, Home-Shopping-Programmen und Mehrwertdiensten aller Art überzog.
Wie schon der Name «Metro» sagte, war sie eng verbunden mit dem städtischen Nahverkehr.
Stenbeck parkte die Gratiszeitung in der Modern Times Group (MTG), einem Spin-off von Kinnevik, in dem damals alle Medienbeteiligungen des riesigen Mischkonzerns zusammengefasst waren. Damit ging er an die Börse. So wurde Kapital mobilisiert für die Revolution im Zeitungsgeschäft, die 1995 begann. Die drei maoistischen Studenten wurden luxuriös abgefunden. Dann startete Stenbeck im Februar 1995 in Stockholm die tägliche Gratiszeitung «Metro». Wie schon der Name sagte, war sie eng verbunden mit dem städtischen Nahverkehr. Die Bahn gestattete die Verteilung, im Gegenzug druckte «Metro» auf eigenen PR-Seiten die Kundenkommunikation des Stockholmer Verkehrsverbundes.
Der Anzeigenverkauf lief besser als erwartet. Schon nach neun Monaten war der Gleichstand von Einnahmen und Ausgaben erreicht, eine rekordverdächtige Leistung. Nach dem ersten Geschäftsjahr war «Metro» die zweitgrösste Zeitung Schwedens. Erste Ableger wurden in Göteborg und Helsinki gegründet. Dann machte sich Stenbeck mithilfe lokaler Scouts auf der ganzen Welt daran, möglichst schnell ähnliche Projekte anzustossen.
Im Fall von Zürich waren die Scouts ein Zeitungsprofi und zwei Quereinsteiger: der frisch entlassene «Blick»-Chefredaktor Sacha Wigdorovits, der PR-Berater Klaus J. Stöhlker und Ove Joansson, der nach einer Rundfunkkarriere vorübergehend schwedischer Diplomat geworden war.
Später, als das Projekt von «Metro» zu Schibsted gewandert war, flog aus Berlin regelmässig Folker Flasse ein, auch er ein Aussenseiter. Früher war er Militärpilot, Luft- und Raumfahrtspezialist und Diplomat gewesen, unter anderem in Pakistan und Indonesien: ein international gehärteter Manager, besonders vertraut mit Logistikfragen.
Und darauf kam es an. Nicht etwa auf den Inhalt. In Stockholm zum Beispiel wurde «Metro» am Anfang von nur etwa zwölf Journalisten gemacht, hälftig aufgeteilt in routinierte Produzenten und junge Reporter.
Die Idee war, «das Erfolgsmodell von Ikea und H&M in die Zeitungswelt zu übersetzen».
Sowohl «Metro» wie Schibsted hatten die gleiche Philosophie, die sich von der nicht gerade wettbewerbsfreudigen Schweizer Zeitungswelt fundamental unterschied: Hierzulande stand am Anfang der Inhalt, dort der Vertrieb und nichts anderes. Die redaktionelle Formel von «Metro» war denkbar einfach und in der ganzen Welt anwendbar: kurze und knappe Berichte in unaufgeregtem Ton, keine Kommentare und tendenziösen Geschichten, höchstens Kolumnen, hoher Bildanteil. Eine Art gedruckte Tagesschau. Die Idee war, «das Erfolgsmodell von Ikea und H&M in die Zeitungswelt zu übersetzen», wie einer der Manager versprach. «Metro» war keine Boulevardzeitung, sondern folgte dem grossen Nachrichtenstrom. Fast food für eilige Leser!
Wenn es keine zwingende Aktualität gab, wurde auch bei «20 Minuten» mit Konsumgeschichten aufgemacht, die auf das junge Publikum zielten, etwa über Handy-Tarife oder Billigflüge. Tatsächlich holte «20 Minuten» den Erfolg dort, wo die herkömmlichen Zeitung die grössten Probleme hatten: bei den jungen Lesern, die damals noch nicht ins Internet abgewandert waren, sich aber von den herkömmlichen Blättern abwandten.
Doch warum hiess die erste Gratis-Tageszeitung in der Schweiz nicht «Metro», sondern «20 Minuten»?
