«Ich schlafe sehr gut und träume auch nicht mehr von Corona.»
Der Datenjournalist Marc Brupbacher berichtet auf tagesanzeiger.ch über Corona so unermüdlich, wie er darüber twittert. Im Gespräch mit der MEDIENWOCHE erzählt er über sein Unverständnis für Corona-Verharmloser und den Triumphzug von Mobile First bei Tamedia.
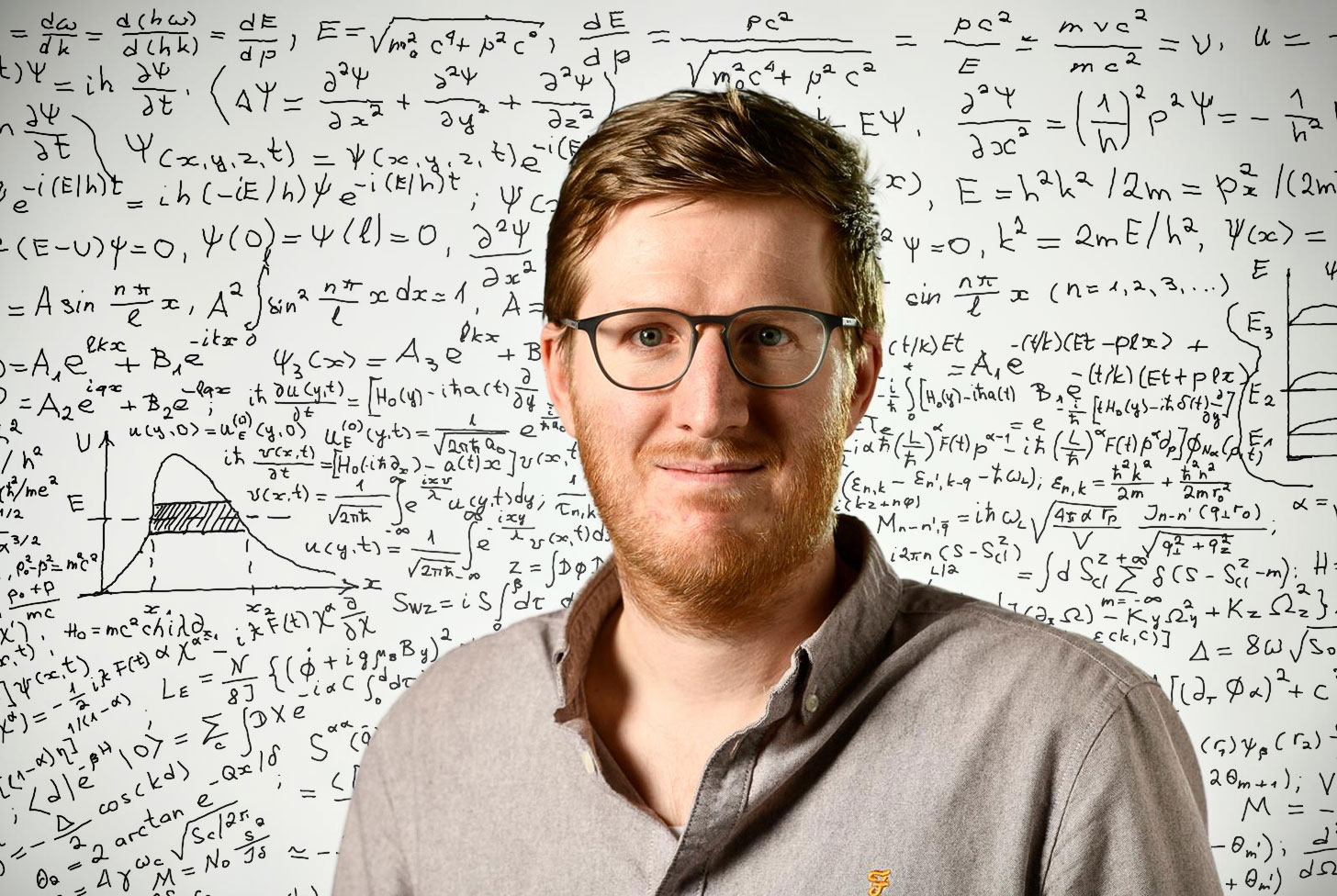
Da erscheint der Kopf im Videocall. Marc Brupbacher (39) trinkt seinen Kaffee aus einer Breaking Bad-Tasse. Bewegt man sich auf Twitter, ist man Brupbachers Gesicht im Pandemiejahr oft begegnet: Unermüdlich präsentiert der Tamedia-Leiter Storytelling Zahlenreihen und Grafiken, interpretiert und polarisiert. Als «Daten-Ayatollah» hat ihn ein anderer Journalist auf Twitter beleidigt. Im Gespräch strahlt der 39-jährige Datenjournalist im Kapuzenpulli weder die Verbissenheit noch die Heiligkeit eines politisch-religiösen Oberhaupts aus.
MEDIENWOCHE:
Es ist der 18. November, die Neuinfektionen gehen in vielen Kantonen zurück. Das kann sich wieder ändern, bis das Interview erscheint, aber: Wie geht es dir aktuell?
Marc Brupbacher:
Die Situation in Bezug auf das Virus bleibt schwierig. Trotzdem gibt es in den letzten Tagen ein paar Lichtblicke, die hoffen lassen: Die Phase-3-Ergebnisse der Impfstoffe stimmen zuversichtlich – oder auch die Wahl von Joe Biden. Alles in allem hätte vieles viel schlimmer rauskommen können, als es Stand jetzt ist. Dennoch: Dass die reiche Schweiz zum Corona-Hotspot wurde und bei sämtlichen Indikatoren im internationalen Vergleich so miserabel abschneidet und dadurch so viel gesundheitliches Leid verursacht, ist durch nichts zu entschuldigen.
MEDIENWOCHE:
Nicht jedes Weltuntergangs-Meme zum Katastrophenjahr 2020 hat sich bewahrheitet.
Brupbacher:
Nicht jedes, ja! Aber trotzdem zu viele.
MEDIENWOCHE:
Gibt es Tage, an denen du dich abschirmst von alldem und den neusten Zahlen?
Brupbacher:
Das wäre natürlich gut – irgendwie habe ich es nicht geschafft. Ich hoffe, es kommt die Zeit, in der ich nie wieder über Corona schreiben muss. Vielleicht werde ich zu den ersten gehören, die sich ausklinken. Vielleicht werde ich Anfang nächstes Jahr sagen: Das war jetzt genug Journalismus zu Corona von meiner Seite. Die Nachberichterstattung und die Auswertung all der Studien, die noch kommen, könnt ihr machen. Ich schreibe keine Zeile mehr über das Virus.
MEDIENWOCHE:
Verabschiedest du dich dann in lange Ferien?
Brupbacher:
Nein. Aber wenn sich die Lage normalisiert, werde ich vielleicht wirklich genug von diesem intensiven Jahr haben und mich wieder anderen Themen widmen. Es ist auch schade, welche unserer Projekte ohne Bezug zu Corona nur ein geringes Publikum erreichten. Unser Klima-Dashboard oder das Quiz zur Vermögensverteilung sind komplett untergegangen. So absurd es ist – und ich kann es nicht ändern: Im Moment interessiert das nur Wenige. Was hatten wir noch?
MEDIENWOCHE:
Die Lonza-Lachgas-Recherche von Christoph Lenz ist doch sehr rumgegangen. Da war euer Team wohl auch beteiligt.
Brupbacher:
Ja, das ist wirklich gut gelaufen! Aber es müssen wirklich Knüllergeschichten sein, wie jetzt Lonza oder die Turnerinnen in Magglingen. Aber was nicht wirklich eine Highend-Recherche ist, vieles im eher unterhaltenden Bereich wie unser Vornamen-Interactive, geht komplett unter.
MEDIENWOCHE:
Spannend. Viele Menschen haben ja das Bedürfnis nach leichteren Themen. Der stetige Informationsfluss ermüdet. Wenn dich «ZEIT Schweiz»-Chef Matthias Daum auf Twitter als «Daten-Ayatollah» beleidigt, wirkt das wie eine solche Ermüdungserscheinung. Man hat genug davon, mit der Zahlenrealität konfrontiert zu werden.
Brupbacher:
Ich glaube auch. Das ist wohl die psychologische Erklärung dafür, dass Leute so hässig sind und dauernd Dinge infrage stellen: Weil es ihnen reicht und sie es nicht mehr hören wollen. Diese Leute kann man manchmal kaum mehr davon überzeugen, dass Fakten halt trotzdem Fakten sind und man an den Zahlen nichts ändern kann. Egal, wie lange man behauptet, sie seien falsch, PCR-Test seien nicht vertrauenswürdig oder 90 Prozent der Infizierten seien asymptomatisch – es stimmt nicht. Es ist der Wunsch, der aus den Leuten spricht, weil sie das Gefühl haben: Mir reicht’s.
«Schon früh bemerkte ich, wie spannend es ist, die Zahlen zu deuten und dass man an ihnen die kommenden Entwicklungen ziemlich gut ablesen kann.»
MEDIENWOCHE:
Trotzdem fällt mir auf: Du interpretierst diese Zahlen sehr entschieden – und twitterst dann vehement. Irgendwann im Mai bin ich dir auf Twitter entfolgt. Nicht, weil ich anderer Meinung war, sondern einfach, weil ich die Informationen bereits aus den Medien kenne und ich in meiner Timeline noch andere Themen sehen wollte. Vor der Pandemie warst du weniger aktiv und nicht immer derart entschieden.
Brupbacher:
Ja. Corona ist halt einfach das dominierende Thema, das alle anderen übertrifft. Schon früh bemerkte ich, wie spannend es ist, die Zahlen zu deuten und dass man an ihnen die kommenden Entwicklungen ziemlich gut ablesen kann. Schnell habe ich auch gemerkt, dass die Deutung nicht Common Sense ist: Die Zahlen werden falsch interpretiert; ich konnte irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen, weshalb das so ist. Diese Falschinterpretationen haben mich sehr beschäftigt. Am Anfang der ersten Welle waren wir eines der stärkst betroffenen Länder weltweit. Wir waren Anfang März in absoluten Zahlen in den Top 10.
MEDIENWOCHE:
Ich erinnere mich.
Brupbacher:
Dann habe ich mir das angeschaut. Was ist da los? Warum handeln unsere Behörden nicht? Auch der Berner Epidemiologe Christian Althaus war alarmiert. Gleichzeitig hat das BAG die ganze Zeit auf Entwarnung gemacht und gesagt, es sei noch nicht so schlimm, wir haben alles unter Kontrolle. Das war eine sehr irritierende Erfahrung – selbst für mich als Laie.
MEDIENWOCHE:
Bereits im Frühling hast du das so empfunden?
Brupbacher:
Du kannst nachschauen auf Twitter. «Wir sind in den Top Ten in absoluten Zahlen – was ist los in der Schweiz?» und rundherum Gelassenheit. Am Anfang hat Daniel Koch gar noch behauptet, Covid-19 sei nicht schlimmer als eine Grippe. Dabei zeigten sämtliche Untersuchungen, Berichte und Studien was anderes. Wie kann das sein?
«Im Thema Epidemie war ich nicht speziell drin, sondern als Journalist einfach ein professioneller Dilettant.»
MEDIENWOCHE:
Du sagst klar, dass du Laie bist. Als ich in der Schweizer Mediendatenbank nachschaute, was du in deinen 17 Jahren im Journalismus alles so geschrieben hast, fielen mir darunter immer wieder Texte zu Viren und Epidemien auf. 2003 über das Norovirus, 2009 was zur Schweinegrippe und dein erster «Datenblog»-Beitrag im «Tages-Anzeiger» trug den Titel: «Healthmap.org kann vor Epidemien warnen». Haben dich Epidemien schon immer interessiert?
Brupbacher:
Nein, in der Anfangszeit kann man seine Themen oft nicht wählen. Bei «20 Minuten» in St. Gallen über die Vogelgrippe schreiben – das hätte ich eigentlich lieber nicht gemacht. Ich weiss noch, wie mich das angegurkt hatte. Im Thema Epidemie war ich nicht speziell drin, sondern als Journalist einfach ein professioneller Dilettant, der sich erst einlesen musste.
MEDIENWOCHE:
Woran habt ihr euch im Interaktiv-Team orientiert, als es um die Datenaufbereitung für euer Covid-Dashboad ging?
Brupbacher:
Ganz am Anfang hatten wir keine eigene Seite, sondern einfach die Schweiz-Zahlen in Artikel und Ticker eingebettet. Irgendwann sagten wir uns, wir machen eine eigene Seite. Das kam so: Ein Freund von mir, ein Datenanalyst, kontaktierte mich und bot seine Expertise an. Mit ihm zusammen haben wir das dann gemacht.
MEDIENWOCHE:
Der arbeitet gar nicht bei Tamedia oder der TX Group?
Brupbacher:
Genau.
MEDIENWOCHE:
Aber er wurde schon bezahlt, hoff ich.
Brupbacher:
Ja, das haben wir als Freelancer honoriert. Lange war er auch nicht dabei, aber in der Kick-off-Zeit hat er uns geholfen. Zu Beginn war nur wichtig, ob sich die Kurve der Neuansteckungen krümmt, wir haben den Fokus daraufgelegt und dies mit einer logarithmischen Skala visualisiert. Zudem war die Frage wichtig: Wie schnell verlangsamt sich die Verdoppelungszeit der Fallzahlen? Das zeigte er uns am Anfang und half uns bei den Berechnungen. Seither haben wir massiv ausgebaut: Erst waren es drei Visualisierungen – heute haben wir 25, die wir permanent aktualisieren. Und das alles mit den Leserinnen und Lesern zusammen! Es sind tausende Mails, die wir zum Dashboard bekommen haben. Zum Teil von Profis, zum Teil von Laien, die uns gefragt haben: Warum macht ihr es so und nicht so? Es war grossartig. Vieles davon haben wir auch umgesetzt. Durch das Feedback haben wir auch mitbekommen, was die Leute unverständlich finden, etwa die Anzeige der Fallverdoppelungszeiten. Dort bauten wir deshalb eine Tangente ein, welche mehr Orientierung bot. So haben wir es mit den Lesern verbessert.
MEDIENWOCHE:
Habt ihr dafür mehr Personal im Interaktiv-Team bekommen?
Brupbacher:
Nein, das haben wir alles zu fünft gemacht. Ich antworte auch fast allen, die uns schreiben. Nur Corona-Skeptikern nicht mehr.
«In unserem Dashboard werden die Zahlen nicht kommentiert – das ist der Unterschied zu dem, was ich auf Twitter mache.»
MEDIENWOCHE:
Im Unschärfebereich zwischen Verschwörungstheorien, Verharmlosung und berechtigter Kritik gab es im Sommer, als die Infektionszahlen tief waren, oft den Vorwurf, die «Mainstream-Medien» würden sich auf die jeweils höchste Zahl stützen, weil sie Klicks wollen. Wie geht es dir mit dem Wissen, dass die Daten relevant sind, aber man sich dem Vorwurf nicht entziehen kann: Man will gelesen und geklickt werden.
Brupbacher:
Unser Dashboard hat immer denselben nüchternen Titel. Wir passen den nicht an, wir stellen die Grafiken nicht um, damit der alarmistischste Wert zuoberst ist. Das ist alles nüchtern gehalten und wird jeden Tag gleich aufbereitet. Jeder kann daraus seine Schlüsse ziehen. Die Zahlen werden nicht kommentiert – das ist der Unterschied zu dem, was ich auf Twitter mache. Auch generell empfand ich die Medienberichterstattung im Sommer nicht als zu alarmistisch. Eher im Gegenteil: Es wurde zu selten darauf aufmerksam gemacht, dass der R-Wert die ganze Zeit über 1 ist und die Zahlen exponentiell steigen.
MEDIENWOCHE:
Ich weiss nicht, ob ich an der Stelle weiterreden sollte, denn nun käme ich über den Kurs der «Sonntagszeitung» zu sprechen – und ich möchte dich nicht unbedingt in die Situation bringen, dass du über dein eigenes Medienhaus urteilen musst.
Brupbacher:
Wir sind eine Forumspublikation. Wir haben so viele verschiedene Meinungen und Ansichten publiziert, auf der eigenen Redaktion. Das ist so – da hat es wirklich alles gegeben.
MEDIENWOCHE:
Es gibt viele Journalistinnen, Journalisten, die sagen, sie hätten diesen Beruf ergriffen, weil er nichts mit Mathe zu tun hat. Wie geht es dir bei dem Satz?
Brupbacher:
Nein, das habe ich nie so empfunden …
MEDIENWOCHE:
Aber nervt es dich, wenn du das hörst?
Brupbacher:
Es nervt mich nicht. Es ist gut, dass wir verschiedene Expertisen auf einer Redaktion haben, denn so kann man sich gegenseitig helfen. Es braucht keine hundert Datenjournalisten und das Datenteam macht ja nicht bloss eigene Beiträge, sondern ist auch eine Anlaufstelle für alle auf der Redaktion. Aus ganz Tamedia habe ich fast täglich Anfragen. Jeder Journalist, der eine Zahl einbaut, oder etwas über Verdoppelungszeiten wissen will, ruft mich an. Wie ist die Testpositivitätsrate? Wie schätzt du XY ein? Dann fragt der mich aus. Besser, als wenn es jede Person für sich selbst rausfinden müsste.
MEDIENWOCHE:
Es braucht keine hundert Datenjournalistinnen, -journalisten. Braucht es noch mehr oder hat es bereits genug?
Brupbacher:
Ich glaub, es sind genug. Es gibt ja auch immer Wechsel, von daher ist es gut, wenn es weiter Nachwuchs gibt. Zudem können Journalisten ja auch datenaffin sein, ohne gleich Datenjournalisten zu sein. Den Bereich Datenjournalismus muss man jetzt nicht mehr gross ausbauen. Tamedia hat sehr viele Datenexperten. Das ist gut und reicht.
«Mathematik fiel mir in der Schule nicht schwer. Fremdsprachen sind mein Feind.»
MEDIENWOCHE:
Und wie bist du zum Datenjournalisten geworden?
Brupbacher:
Begonnen hat es mit dem Data Blog des Guardian vor etwa zehn Jahren. Das faszinierte mich: Wie arbeiten Journalisten, die mit Daten operieren? Wie visualisieren sie ihre Arbeit? Das interessierte mich und deshalb schlug ich beim «Tages-Anzeiger» einen solchen Datenblog vor. Als das für gut befunden wurde, konnte ich da experimentieren. Auch hier als Laie, als professioneller Dilettant, als Journalist. Irgendwann beginnt man damit, diese Geschichten zu machen. Geschichten, die das Publikum wahnsinnig interessieren. Dabei lernt man wahnsinnig viel, lernt, was man das nächste Mal anders macht. Man lernt über Statistik, über den Unterschied zwischen Median und Durchschnitt, wie man etwas richtig ins Verhältnis setzt, weshalb absolute Zahlen nicht sinnvoll sind. Dabei entwickelte ich ein Gespür – aber eine Vorbildung hatte ich überhaupt nicht, ich bin da reingerutscht.
MEDIENWOCHE:
Aber du warst gut in Mathe?
Brupbacher:
Doch! Schon … Ich war nicht auf Kriegsfuss mit den Zahlen. Mathematik fiel mir in der Schule nicht schwer. Fremdsprachen sind mein Feind. Dort habe ich eine Blockade im Kopf – Deutsch und Mathe liegen mir.
MEDIENWOCHE:
Bevor du Leiter Storytelling geworden bist, warst du Leiter Newsdesk. Das tönt fast wie das Gegenteil: Agenturmeldungen aufbereiten und schnell reagieren versus Datentiefe und möglichst langfristige Aussagefähigkeit. War das ein grosser Wechsel?
Brupbacher:
Online gab es kaum Jobs neben dem Newsdesk. Anfangs wollte mich Peter Wälty eigentlich ins Zürich-Ressort tun, weil ich einiges an Erfahrung im Lokaljournalismus hatte. Als ich lieber ans Newsdesk wollte, konnte er eigentlich nicht verstehen, weshalb man das lieber wollen kann als Reporter zu sein. Ich hatte damals einfach keinen Bock mehr auf Lokalgeschichten und wollte über allgemeine Themen berichten. Am Newsdesk lernte ich unsäglich viel über das Weltgeschehen, die Einordnung von Meldungen, produzieren, kürzen, redigieren, blattmachen, eine gute Mischung hinbekommen. Oft ist man ganz alleine – ich hatte da erst wenig Erfahrung. Die Verantwortung ist eigentlich Wahnsinn – aber ich blieb hartnäckig. Die Leute sind gekommen und gegangen und ich bin am Newsdesk geblieben. Dadurch bin ich dann aufgestiegen, konnte selber gestalten, Konzepte wie den Datenblog umsetzen und schliesslich mein eigenes Team mit Programmierern haben. Das war immer ein Wunsch, dass ich als Journalist Programmierer in meinem Team habe. Und dann tolle Sachen machen kann.
MEDIENWOCHE:
Wie sehr ist Datenjournalismus Teamarbeit? Könntest du – mit unendlich viel Zeit – so etwas wie das Corona-Dashboard alleine machen?
Brupbacher:
Alles, was wir machen, tun wir im Team. Dabei bin ich meist Ideengeber und Regisseur, aber dann braucht es einen Programmierer, einen Gestalter. Manchmal brauchen wir dann die Expertise von Data Scientists. Häufig kontaktieren wir die Data Scientists auch noch für einen Lastlook. Um zu fragen: Die Berechnung, die wir jetzt machen, findest du das sinnvoll?
MEDIENWOCHE:
Und die Data Scientists sind auch im Haus?
Brupbacher:
Ja, die sind im Datenteam vom Dominik Balmer. Patrick Meier zum Beispiel. Das sind dann wirklich die Datencracks. Dafür können sie weniger gut visualisieren als wir.
MEDIENWOCHE:
Deine Kernkompetenz ist es, Ansätze für Datengeschichten zu finden.
Brupbacher:
Genau. Der Ansatz, der Inhalt, der Text, das Wording, die Position und die Art, wie man Sachen darstellt. Das kommt von mir. Danach setzen wir das aber im Team um. Es geht nur im Team. Darum ist jetzt auch diese Nominierung für den «Rechercheur des Jahres» vom «Schweizer Journalist» etwas unangenehm. Eigentlich sollte das Team da nominiert sein.
MEDIENWOCHE:
Du bist der einzige Journalist?
Brupbacher:
Im Interaktiv-Team, ja. Über die Redaktion hinweg gibt es einige Datenjournalisten.
«Intern nutzen wir den Begriff Storytelling für den Bereich, in dem es darum geht, wie wir Geschichten im Mobile aufbereiten und erzählen.»
MEDIENWOCHE:
Als Leiter Storytelling untersteht dir ja auch die 12-App und vieles, vieles anderes. Wie viel von deiner Arbeit macht das aus, worüber wir bisher gesprochen haben?
Brupbacher:
Den grössten Teil.
MEDIENWOCHE:
Und die anderen Sachen?
Brupbacher:
Die Blogs und die 12-App haben jeweils eine eigene Leitung. In anstrengenden Zeiten kann ich mich da etwas rausnehmen.
MEDIENWOCHE:
Gerne möchte ich mit dir noch über das Wort «Storytelling» sprechen. Journalisten, Journalistinnen verstehen darunter Multimedia – alle anderen denken beim Begriff immer noch an gut erzählte Texte …
Brupbacher:
Ja! Der Begriff ist wohl ein wenig verwirrend, vielleicht müsste man das einmal auflösen. Man könnte sagen, ich bin Leiter des Interaktiv-Teams. Der Begriff hat von Anfang immer für Verwirrung gesorgt. Intern nutzen wir den Begriff Storytelling für den Bereich, in dem es darum geht, wie wir Geschichten im Mobile aufbereiten und erzählen. Im letzten Jahr ist das ein grosses Thema für uns, weil wir auf Mobile First umgestellt haben und mobile nicht alles gleich funktioniert. Wie muss man schon vor dem Recherchieren, lange vor dem Schreiben, an eine Geschichte angehen, damit sie genau die Form erhält, die in Mobile-Geräten am besten zur Geltung kommen? Das nennen wir bei uns Storytelling-Aspekte.
MEDIENWOCHE:
Tourst du denn auch durch die verschiedenen Tamedia-Lokalredaktionen, um den Leuten den Mobile First-Ansatz näherzubringen?
Brupbacher:
Das gehört schon auch zu meinem Bereich. Ich leite das nicht, aber es wäre vorgesehen gewesen, dass ich das mache. Wegen Corona ist es nicht dazu gekommen.
MEDIENWOCHE:
Verstehst du Kolleginnen, Kollegen, die bei diesem Mobile First, bei Schlagwörtern wie SEO, vielleicht sogar bei Storytelling zusammenzucken und das Gefühl haben «Es geht doch eigentlich darum, was ich schreibe!»?
Brupbacher:
Das gibt es eigentlich immer weniger.
MEDIENWOCHE:
Das gibt es nicht mehr so viel?
Brupbacher:
Nein. Sie dürfen ja auch noch immer ihre Essays schreiben und ihre Reportagen und Lesetexte. Dort braucht es für den Mobile Screen oft nicht mal was anderes.
«Man hat zehn Jahre lang gepredigt, ihr müsst ans Online denken. Aber solange die Produktionsprozesse auf die Zeitung ausgerichtet sind, ändert sich nichts.»
MEDIENWOCHE:
Was war dein liebster Tamedia-Lesetext in diesem Jahr? Etwas, das mehr oder weniger eine Bleiwüste ist.
Brupbacher:
Das ist schon die Geschichte im «Magazin», in der die acht Turnerinnen erzählen, was sie in Magglingen aushalten mussten. Das war eine der besten Geschichten in diesem Jahr – die schon ein wenig bleiwüstig dahergekommen ist.
MEDIENWOCHE:
Je nachdem, womit man sie vergleicht.
Brupbacher:
Das war so stark vom Inhalt her. Es spielt keine Rolle, wie man das aufbereitet. Eine solche Geschichte spricht für sich selber.
MEDIENWOCHE:
Manchmal übertrifft also der Inhalt die Form.
Brupbacher:
Ja. Es macht keinen Sinn, Pseudo-Storytelling zu machen. Jedes Essay und jede Reportage künstlich zu zerstückeln und zu verformen, bringt nichts. Aber es muss eine gute Mischung sein! Es darf nicht alles voller Lauftext sein, ohne Bilder, ohne Grafiken, ohne Einschübe, ohne Konzepte. Ich hab nicht das Gefühl, dass es jetzt noch viele Leute gibt, die sich sträuben. Der entscheidende Punkt ist: die Priorität. Man hat zehn Jahre lang gepredigt, ihr müsst ans Online denken. Aber solange die Produktionsprozesse auf die Zeitung ausgerichtet sind, ändert sich nichts. Seit einem Jahr setzen wir auf Mobile First – und alles ist darauf ausgerichtet. Die Leute erfassen im CMS bloss noch den Onlineartikel. Ins Print giesst ihn am Abend dann noch die Produktion. Und so müssen die Leute mit der Technik klarkommen, mit dem Content Management System, mit den neuen Abläufen und so lernen sie auch die Möglichkeiten kennen. Und so geht es dann plötzlich auch! Die Artikel sehen jetzt besser aus, sie sind sauberer produziert, sie sind keine Bleiwüsten mehr. Du kannst das nicht einfach freiwillig gestalten. Man muss die Strukturen verändern und dann hat auch niemand mehr Mühe damit, so wie ich das beurteile.
MEDIENWOCHE:
Du warst im Newsnet angestellt, als Online noch der Sonderfall war.
Brupbacher:
Es war der Horror. Zehn Jahre lang für etwas kämpfen zu müssen, das selbstverständlich sein sollte. Und man war wirklich auf verlorenem Posten. Es hat sich niemand fürs Online interessiert. Jetzt ist es umgekehrt, du musst es dir mal vorstellen! Letztens rief mich der Tagesleiter abends um 7 oder 8 an, weil er noch einen Print-Frontanriss für meinen Artikel wollte. Da ich ab 7 Uhr arbeite, war ich da unterwegs, also sagte ich: «Ich kann den Frontanriss nicht schreiben. Frag doch den Dienst, der muss meinen Text eh noch kürzen.» Die Redaktorin habe auch keine Zeit. Es sei verrückt: Niemand kümmere sich mehr um Print. Da hat er recht, denn noch immer kommen die Einnahmen vor allem aus dem Print. Dem Tagesleiter antwortete ich: «Welcome to my world!» So war das die letzten zehn Jahre lang: Ich bin immer sitzen gelassen worden, immer im Seich gelassen worden – alleine! Jetzt sind es die, die den Print-Abschluss machen müssen.
«Es werden nicht einfach alle Medien eingehen. Irgendeine Lösung wird es geben.»
MEDIENWOCHE:
Im Zuge der Pandemie werden momentan bei allen grossen Medienhäusern beschleunigt Stellen gestrichen. Hast du das Gefühl, der wirtschaftliche Turnaround ist bald geschafft und das Publikum lernt, für Journalismus im Internet zu zahlen, wie es das auch eure Mobile First-Strategie erreichen will?
Brupbacher:
International zeigen immer wieder Beispiele, dass die Finanzierung von Online-Medien mit Abos klappen kann. In der Schweiz zeigt die Republik, dass es möglich ist. Die NZZ hat ermutigende Zahlen veröffentlicht und unsere Zahlen sind auch gut. Ob das reicht, weiss ich nicht. Doch wenn es Tamedia oder die NZZ nicht schaffen, würde es niemand schaffen. Das wird nicht passieren: Es werden nicht einfach alle Medien eingehen. Irgendeine Lösung wird es geben. Momentan sieht es jedenfalls nicht schlecht aus.
MEDIENWOCHE:
Auch in Bezug auf die Pandemie äussern momentan viele scheuen Optimismus. Hast du das Gefühl, dass die neuen Gräben nach der Pandemie bleiben?
Brupbacher:
Ich denke es. All die Verharmloser und Verschwörungstheoretiker waren vorher nicht sichtbar. Jetzt werden sie es. Sie sind vielleicht eine Minderheit, aber eine bedeutende. Sie werden wohl weiterhin an offensichtlichen Fakten und Tatsachen, die wir akzeptieren müssen, zweifeln. Als Gesellschaft müssen wir Tatsachen akzeptieren, selbst wenn sie bloss vorläufig sind. Alles Wissen ist vorläufig. Es ist beängstigend, wie konstant die Corona-Zahlen – auch von Ärzten – hinterfragt werden. Dabei ist es normal, dass Studien nie eins zu eins Abbild der Realität sind. Auch wenn du rausfinden willst, ob die Insektenpopulationen sinken, zählst du nicht alle Insekten der Welt, sondern ziehst Schlüsse aus kleinen Beispiel-Datensätzen. Das gilt für jede Wissenschaft. Aber in der Pandemie wird jedes Fitzelchen Information infrage gestellt. Sie behaupteten monatelang, dass die wenigen False-positive-Tests alle Erkenntnisse zur Pandemie-Eindämmung umkehren. Aber nun, im Nachhinein, kann man klar sagen: Wenn die Fallzahlen gestiegen sind, sind irgendwann auch die Hospitalisierungen gestiegen. Dann ist irgendwann die Testpositivitätsrate gestiegen, dann die Zahl der täglichen Todesfälle, dann die Übersterblichkeit. Das ist doch alles logisch. Nur weil nicht jede Prognose auf den Tag genau präzis ist, heisst es doch noch lange nicht, dass sie falsch oder gar absichtlich getürkt ist. Ob die Schwemme an Verschwörungstheorien nach der Pandemie abnimmt, weiss ich nicht. Aber wir werden nicht einfach in Harmonie übergehen.
MEDIENWOCHE:
Selbst wenn du die Zahlen täglich mitverfolgst: Was ist dein wichtigster Ausgleich in dieser Pandemiezeit?
Brupbacher:
Schlafen. Das ist mein einziger Ausgleich. Es ist erstaunlich, aber: Ich schlafe sehr gut und träume auch nicht mehr von Corona.
Korrigendum: In einer früheren Version dieses Artikels hiess es, Marc Brupbacher trinke seinen Kaffee aus einer Tasse mit einer Abbildung von Werner Heisenberg. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Tasse, die den Breaking Bad-Protagonisten Walter „Heisenberg“ White zeigt.


