«Was kürzer als 35’000 Zeichen ist, finde ich heute schwierig»
So schreibe ich: Urs Mannhart über seine Reportage «Von Männern und Wölfen», erschienen in «Reportagen» Nr. 37. Aus den Beobachtungen und Notizen von zwei dreiwöchigen Kirgistan-Reisen ist auch eine Kurzgeschichte entstanden, die Mannhart beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vorgelesen hat. Über die Arbeitsweise eines Grenzgängers zwischen Literatur und Journalismus.
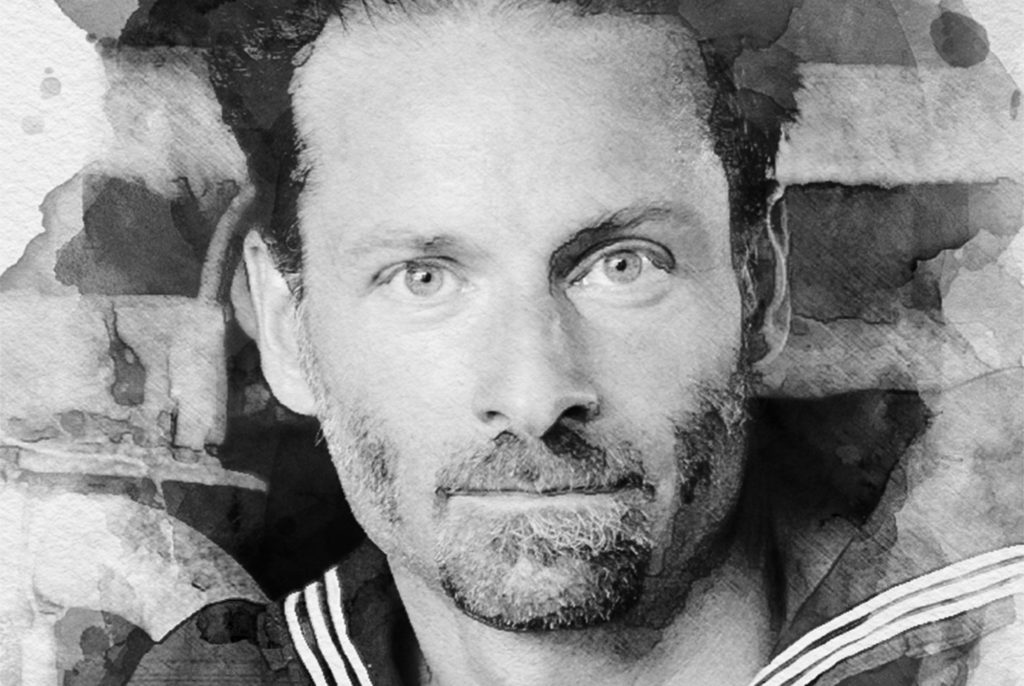
«Ich bin mit Schreibabsicht nach Kirgistan gefahren, allerdings ohne vorher zu recherchieren: Eine Landkarte und Zugtickets von Moskau nach Bischkek für meine Übersetzerin und mich, das war alles. Für mich ist es nicht hilfreich davor, sieben andere Reportagen zu lesen. Denn dann erhellt jemand mit einer Taschenlampe ein paar bestimmte Ecken, die mich ablenken. Lieber gehe ich ganz ins Dunkle.»
Urs Mannhart ist Schriftsteller, Reporter und absolviert momentan eine Lehre auf einem Biobauernhof zwischen Bern und Solothurn.
«Meine zweite Reise nach Kirgistan kostete mich dann den gesamten Jahresurlaub im ersten Lehrjahr. Als ich im November 2016 zurückkehrte, hatte ich ein paar Ideen für die Grundstruktur der Reportage. In den Weihnachtsferien wollte ich mich an die Reportage setzen, aber dann erreichte mich die Anfrage vom Bachmann-Preis aus Klagenfurt. Das weckte mein Interesse, den Text erst einmal in eine andere Richtung zu treiben und die Hirne meiner Protagonisten zu öffnen – was in einer Reportage ja kaum möglich ist. So entstand der literarische Text.»
Die Kurzgeschichte «Ein Bier im Banja» kam bei der Jury in Klagenfurt nicht nur gut an. Die Vorwürfe: Wladimir Putin würde dieser Text gefallen, er entstamme einem Realismus des 19. Jahrhunderts und sei im besten Fall ironisch. Eine Jurorin kritisierte differenzierter mit den Worten: «Er beschreibt eben nur, das ist die Provokation.» In der Reportage «Von Männern und Wölfen» werden die Geschlechterverhältnisse noch stärker betont als in Mannharts Kurzgeschichte. Eine Reaktion auf die Rückmeldungen am Bachmann-Preis?
«Da sich die Darstellung der Geschlechterverhältnisse aus meinem Erleben speist, war ich etwas überrascht, dass dieses Thema von der Bachmann-Jury so stark gewichtet worden ist. Die Reportage habe ich nach Klagenfurt geschrieben, aber die Passagen, die die Geschlechterverhältnisse deutlich machen, besonders die Arbeitsverteilung im Haushalt, waren schon vorher geplant.»
Die Reportage endet mit dem Zielsatz: «Wenn er seine Dose geleert hat, wird er gewiss einverstanden sein, ihr heute noch sein Telefon zu leihen. Einen toleranten Ehemann zu haben, ist ein grosses Glück.» Damit zeigt sie die patriarchalen Verhältnisse in Kirgistan und erlaubt es den Lesenden sich zu positionieren. Mannhart hat sich also Mitte Juli 2017 an diese Reportage gesetzt – mehr als ein halbes Jahr nach seiner zweiten Reise.
«Wenn ich von einer Reise zurückkehre, habe ich meist Angst, zu wenig Material zu haben. Dann tippe ich als erster Arbeitsschritt alle Notizen ab. Am Ende sind es vielleicht 90’000 Zeichen, und ich denke: Ok, wahrscheinlich doch genug. Im Verhältnis zu meiner Gesamtaufenthaltsdauer erscheint mir das trotzdem wenig. Meine Notizen bestehen aus vollständigen Sätzen, aber sie sind von einer ersten Fassung gleich weit entfernt wie vom Stichwort.»
In «Von Männern und Wölfen» werden auch Auseinandersetzungen mit Wölfen szenisch wiedergegeben. An diesen Stellen erinnert die Reportage an einen Abenteuerroman im Stil von Karl May aus dem 19. Jahrhundert.
«Wenn ich denke, dass jemand wie mein Protagonist Asamat glücklicher ist, liegt das sicher auch daran, dass ich Westeuropäer bin. Klar, diesen Blick bekommt man nicht weg, das hat das Schreiben schwierig gemacht. Trotzdem empfand ich es von Beginn weg als Aufgabe, die Einflüsse dieser Perspektive gering zu halten. Wenn in der Schweiz jemand mit einem Feldstecher einen Wolf sieht, ist es anderntags in der Zeitung zu lesen. In Kirgistan packt man dieses Raubtier an den Ohren! Diese riesige kulturelle Distanz fasziniert mich. Und ich wollte sie textlich überwinden.»
In der letzten Zeile der ersten von fünfzehn Seiten steht das einzige «ich» im Text. «…und so, wie sie es erzählt, bin ich sehr gewillt, ihr zu glauben.» Dieses «Ich» prägt die restliche Lektüre, weil es eben das einzige bleibt. Lesende wissen, dass jemand spricht, der von mündlichen Erzählungen abhängig ist und eben – anders als in Mannharts literarischem Text – nicht in die Hirne seiner Protagonisten schauen kann.
«Die Erzählinstanz soll die Perspektive spiegeln – es geht ja darum, dass hier eine Mutter glaubt, ihr Sohn habe aufgrund der Tatsache, dass ihr Vater im Krieg mit dem Blut einer deutschen Pflegerin versorgt worden ist, leicht westeuropäische Gesichtszüge. Eine schwierige Passage, denn ich will mich ja nicht lustig machen über diese Mutter. Deswegen schien mir hier ein Ich nötig. Ich weiss nicht, vielleicht wirkt es von da an während des ganzen restlichen Textes. Wäre aber auch in Ordnung. In solchen Momenten zeigt sich gewiss auch der Unterschied zu anderen journalistischen Texten: Weil der Blick auf die Welt, wie ihn diese Mutter an den Tag legt, nicht in unsere aufgeklärte Welt passt, hätte diese Aussage in einem anderen Text vielleicht gar keinen stimmigen Platz gefunden. Dabei erzählt sie viel über das dortige Denken.»
Das Ich stand da nicht von Anfang an, sondern wurde von Mannhart in der Überarbeitung ergänzt. Mannhart schätzt, wie konzentriert bei «Reportagen» redigiert wird. Im finalen Text ist diese eine «Ich» nun entscheidend für ihn. Angetrieben durch die Rückfragen und Inputs der Redaktion fügte er unter anderem der perspektivischen Kniff mit dem «Ich» ein.
«Meine Zusammenarbeit mit «Reportagen» dauert ja schon eine Weile an, darum weiss ich, dass sie froh sind um eine Fassung, bei der noch einige Dinge formbar sind. Innerhalb der einzelnen Abschnitte war die redigierende Redaktorin prägend, aber was die Grundstruktur anging, nicht. Mit dem Titel habe ich auch nichts zu tun. Bis heute wüsste ich nicht, wie ich diesen Text betiteln würde.»
«Von Männern und Wölfen» berichtet auch von einer Erzählkultur. Das Ich markiert das, der episodische Aufbau bildet das ab: Man liest und überliest dann fast, dass man von einer Familienanekdote in die Makrogeografie gelangt, von einer kurzen Biografie in eine detaillierte Erklärung über die medizinische Anwendung von Wolfsleber, vom Kampf mit einem Wolf in die zweiseitige Beschreibung einer Partie Kok-Boru, ein Spiel bei dem Männer auf Pferden vor einem Publikum aus Männern versuchen, eine tote Ziege mit einem Arm zu ergreifen.
«Wenn man in der Jurte zusammensitzt und Stutenmilch trinkt, geht es meist vom Hundertsten ins Tausendste. Wenn der eine ein Thema anschneidet, kommt dem anderen noch was in den Sinn. Dann lässt der sich unterbrechen, denn der Unterbrecher durfte noch nicht so viel erzählen. Eine halbe Stunde später kommt es dann wieder zum Vorherigen zurück. Diese Stimmung wollte ich zumindest implizit abbilden.»
Nach dem zweiseitigen Cliffhanger springt die Reportage wieder zum szenischen Höhepunkt des Textes: zu Kalmirsas Kampf mit einem Wolf. Auch diese entstand als Destillat von zahlreichen, sich gegenseitig präzisierenden Erzählstimmen. Die journalistische Sauberkeit bleibt gewahrt dank dem einführenden Satz: «Auch eher aussereuropäisch ist die Geschichte Kalmirsas, die in Suusamyr Aufsehen erregt, und die Geschichte geht so:»
«Wir sind zwei Mal drei Stunden gefahren, um mit Kalmirsa zu sprechen. Beide Male war er entgegen seinem Versprechen nicht zuhause. Beim zweiten Anlauf war immerhin seine Frau da, mit ihr die halbe Verwandtschaft und zwei Nachbarn. Ich stellte eine einzige Frage: «Wie war das damals, als dein Ehemann vom Wolf gebissen wurde?» Danach konnte ich den ganzen Abend lang zuhören und notieren. Die vielen Leute, die die Erzählung der Frau mit Einwürfen und Widerreden garnierten, hatten ein vitales Interesse daran, die Wahrheit zu erzählen. Wenn es auch bloss ihre eigene Wahrheit war, hatte ich so doch immerhin eine minimale Garantie, dass sich diese Geschichte ungefähr so abgespielt haben musste! Weil die erzählten Details dicht waren, hatte ich keine Mühe, anschaulich zu beschreiben. Oft ist es ja überraschend schwierig, von Dingen zu schreiben, die man selbst erlebt hat. Bei Szenen, die ihre Basis in meinem Erleben haben, bin ich manchmal, auch wenn es um Grundsätzliches geht, ziemlich blind.»
In den redaktionellen Leitlinien von «Reportagen» steht: «Wir lieben die literarische Reportage, solange die Autorinnen und Autoren kein reines «l’art pour l’art» betreiben, sondern ihre Könnerschaft in den Dienst des recherchierten Stoffs stellen.» Aber was soll das denn sein, eine «literarische Reportage»?
«Bei einer literarischen Reportage steht für mich das Erzählen klar im Vordergrund – deshalb darf das Thema abseitiger sein als in herkömmlichen journalistischen Texten. Als Schriftsteller glaube ich: Wenn etwas schön erzählt ist, findet es Anklang bei der Leserschaft.»
Der Fokus auf den Stil ändert nichts an der Verpflichtung gegenüber dem journalistischen Ethos. So steht es in den Leitlinien von «Reportagen». Mannharts Bezug zu seiner Arbeit ist aber insofern anders als jener von angestellten Journalisten, weil er in seinem Schreiben keine Deadlines kennt. Er findet bereits die Frage sehr spekulativ, ob mit Deadline ein anderer Text entstanden wäre, weil er sich nicht vorstellen kann, dass eine Redaktion jemanden mit einem Schreibauftrag nach Kirgistan schickt.
«Ich habe mit den meisten Texten im Tagesjournalismus das Problem, dass sie ihre Genetik verschleiern. Mir gefällt der Raum, der es erlaubt, die Entstehungsgeschichte eines Textes fühlbar zu machen.»
Im Unterschied zur Kurzgeschichte ist in der Reportage der Bezug zur Realität transparent und bindend. In «Von Männern und Wölfen» wird klar, was Mannhart erlebt hat und was er nur gehört hat. Mannhart arbeitet in der Reportage journalistisch – auch wenn manche Passagen nicht von einer Realität sondern einer Erzählkultur berichten.
Schon als Mannhart während seiner Studienzeit für den «Bund» arbeitete, ging er am liebsten an «irgendeine Hundsverlochete», bei der es ums Beschreiben von Atmosphäre ging. Seine Interesse am Abseitigen beruht auf Überzeugung:
«Meist erzählt ein Gespräch mit dem Abwart mehr als die ausgewogen verteilten O-Töne der drei wichtigsten Entscheider über eine Mehrzweckhalle. Mich interessiert eine Flughöhe, die im Tagesjournalismus nur selten möglich ist. Vielleicht hätte ich schon damals, als ich im Tagesjournalismus gearbeitet habe, den Mut haben müssen, nach mehr Platz zu fragen. Den Mut zu sagen, dass ich nicht nur Bericht erstatten, sondern darlegen möchte, wie ich vorgegangen bin, Atmosphäre vermitteln. Inzwischen hätte ich sicher auch mit dem Umfang Mühe: Alles, was kürzer als 35’000 Zeichen ist, finde ich heute schwierig.»
Bild: Aurélie Zaugg, Bearbeitung: Marco Leisi


