«Spiegel»-Journalismus: Wir sagen, was ist
Der Fall Relotius zeigt die Krise eines Journalismus, der sich als Wirklichkeitserschaffer versteht und für eine stimmige Story auf die Fakten pfeift.
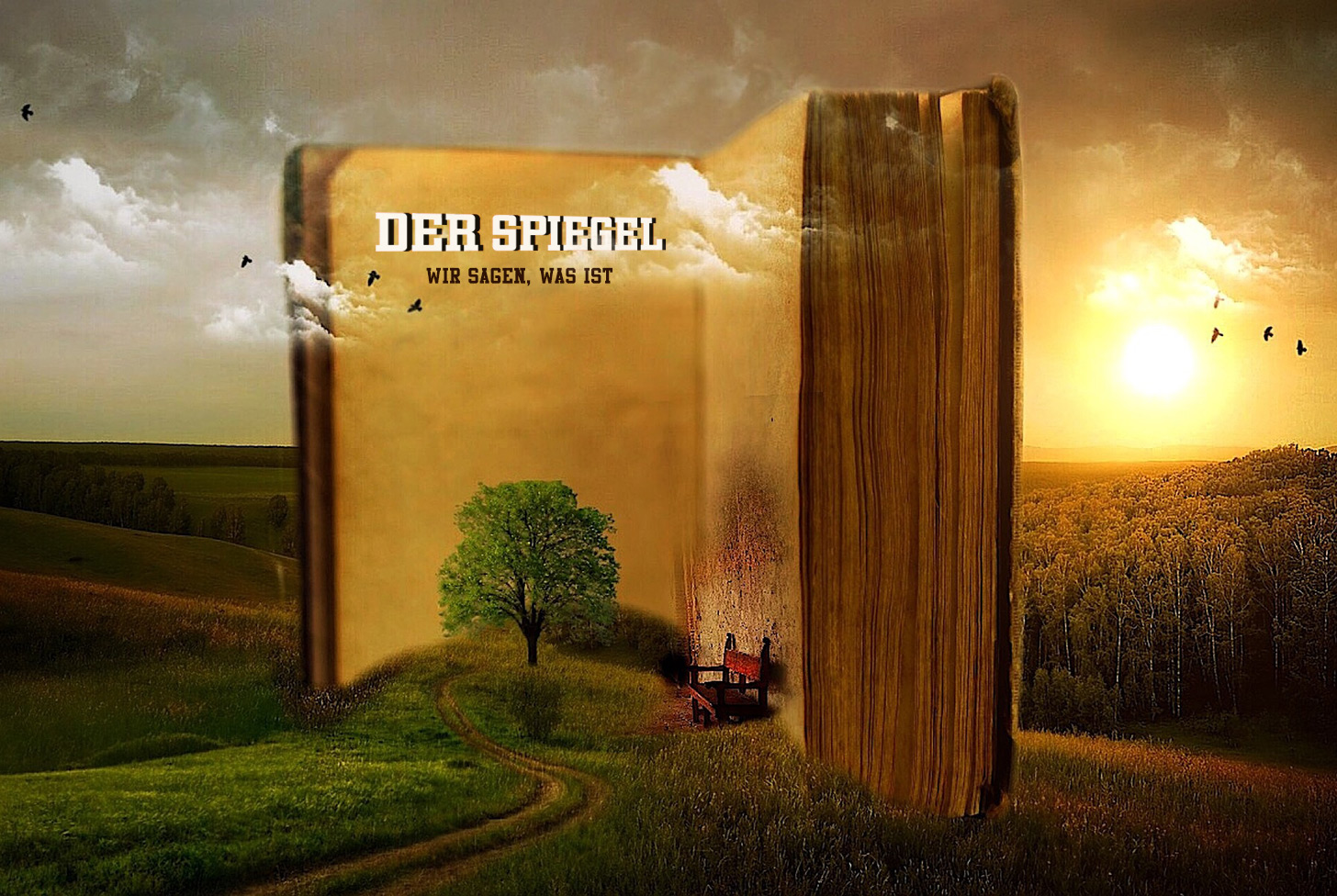
Bereits 1957 hatte der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger in seinem Aufsatz über die «Sprache des Spiegels» festgestellt, dass es sich beim «Spiegel» gar nicht um ein Nachrichtenmagazin handele: «Der redaktionelle Inhalt besteht vielmehr aus einer Sammlung von ‹Storys›, von Anekdoten, Briefen, Vermutungen, Interviews, Spekulationen, Klatschgeschichten und Bildern». Und die «Einblicke und Enthüllungen, die ihm [dem Leser] das Magazin verschafft, machen ihn zum Voyeur: Er darf, ohne dass er für irgend etwas verantwortlich wäre, ‹hinter die Kulissen› sehen. Was dem Leser derart angeboten wird, ist die Position am Schlüsselloch. Die Entscheidung nimmt ihm das Magazin ab: Sie wird in der Story präfabriziert. Während die Nachricht als zuverlässiges Mittel zur Orientierung eigenen Verhaltens dient und insofern ein Produktionsmittel ist, bleibt die Story reines Konsumgut. Sie wird verzehrt und hinterlässt nur emotionale Rückstände, die als Ressentiment wirksam werden…»
***
Unser Dossier zum Fall Relotius.
***
Mit dieser Kritik im Ohr relativiert sich einiges an der vor Weihnachten aufkochenden Empörung um jenen Claas Relotius, der in seinen mehr als 50 Texten (binnen weniger Jahre) für den «Spiegel» und andere renommierte deutschsprachige Magazine Erfindungen eingestreut oder, wenn man es deutlich formulieren will, gelogen hat. Nicht immer, aber durchaus regelmässig. Schonungslos wolle man dies aufarbeiten, so Ullrich Fichtner, Mitglied der Chefredaktion des Nachrichtenmagazins. Im Heft vom 22. Dezember 2018 begann diese Aufklärung.
(Die Texte der Titelstory sind frei im Internet verfügbar.)
Der einst hochgejubelte Held Relotius muss gehen und gleichzeitig wird der neue Held Moreno aufgebaut; man hört schon die Laudationes bei den nächsten Preisvergaben.
Und sie lesen sich – wie könnte es anders sein – im typischen «Spiegel»-Stil. Man erfährt beispielsweise, die meisten Kollegen hätten erschüttert reagiert. Und: «Bei einigen fliessen Tränen.» Aber Rettung nahte und dem «bösen» Relotius wird der «gute» Juan Moreno gegenüber gestellt. Moreno, im Gegensatz zum festangestellten Relotius «nur» freier Autor, recherchierte gegen Widerstände, die ihm in der Redaktion ob seiner Zweifel an Relotius‘ Arizona-Story entgegen schlugen, weiter, teilweise «auf eigene Kosten». Eine Art Woodward 2.0 sozusagen. Der einst hochgejubelte Held muss gehen und gleichzeitig wird ein neuer Held aufgebaut; man hört schon die Laudationes bei den nächsten Preisvergaben.
Der «Spiegel» gibt sich zerknirscht. Mit Giovanni di Lorenzo hat man sich den Chefredakteur des Konkurrenzmediums «Die Zeit» zum Gespräch geholt. Di Lorenzo pflegt auch keine kollegiale Zurückhaltung und konstatiert «gewisse Formen der Überhöhung» beim «Spiegel» als «besonders ausgeprägt». Sachverhalte würden zuweilen «attraktiv» dramatisiert und die Recherche teilweise «zugunsten einer besonders schlüssig oder plausibel klingenden Geschichte» vernachlässigt. Das sagt jemand, dessen Blatt Anfang 2018 eine mit reichlich Vorwürfen gespickte, mindestens kontrovers diskutierte, im Anklagemodus verfasste Story über den Fernsehregisseur Dieter Wedel und dessen sexueller Übergriffigkeiten (bis hin zur Vergewaltigung) publizierte.
Damit fallen immer mehr die Neutralitäts- und Objektivitätsschranken. Journalisten begreifen sich als politische Aktivisten.
Natürlich stellen sich im Fall Relotius auch Fragen nach dem Personenkult, dem der Journalismus (ähnlich wie der Literaturbetrieb) immer mehr zu erliegen scheint. So gibt es im Fernsehen Dokumentationsformate, die fortlaufend den Autor bei der Arbeit im Bild zeigen. Er wird zur Hauptfigur, nicht die Sache selber. Talkshows tragen die Namen ihrer Moderatoren. Man begreift sich zusehends als politische «Vierte Gewalt», in dem man die drei Gewalten miteinander vereint und damit Ermittler, Ankläger und Richter in einer Person ist. Damit fallen immer mehr die Neutralitäts- und Objektivitätsschranken. Journalisten begreifen sich als politische Aktivisten. «Haltungsjournalismus» wird als Maxime des Handelns begriffen. Journalistenpreise werden wegen einer «Haltung» vergeben. Das erzeugte journalistische Produkt scheint eher nebensächlich zu sein. Was man früher nur in Kommentaren fand – die Meinung des Journalisten – wird nun Basis für das Berichten. Der Rezipient kann kaum noch zwischen Meinung, die zur «Gewissheit» wird, und Faktum unterscheiden. Das ist durchaus gewollt. «Berichterstattung und Haltung kann man nicht trennen» postuliert denn auch ein «Spiegel»-Kolumnist grossspurig, aber durchaus verallgemeinerbar für den Trend.
Über einige der Geschichten von Relotius, die ich jetzt – zugegebenermassen nachträglich und mit Wissen um deren Lügenhaftigkeit – gelesen habe, kann ich nur den Kopf schütteln. Zunächst darüber, dass die Fakten dort nicht stimmen bzw. nahezu alles erfunden sein soll und das angeblich so grandiose 60-köpfige Rechercheteam vollends versagt haben muss. Aber auch über den Duktus, die Sprache, die unterschwellige «Botschaft» wäre einiges zu sagen, denn was hier vorliegt, ist eine Mischung aus Heftchenroman, Kolportage und Gesinnungskitsch. Ein stellenweise ungeniessbarer, überzuckerter Brei, der, bei entsprechender Konditionierung ein diffuses Wohlbehagen bei einer gewissen Klientel zu erzeugen vermag, nicht zuletzt weil «Gewissheiten» mit Stereotypen bedient werden. Da erfüllt einer die Erwartungen der Chefredaktion, des Publikums, des Zeitgeistes. Dies ist durchaus kein Alleinstellungsmerkmal eines Claas Relotius.
Die zunehmende Infiltration des Journalismus durch fiktionale Elemente ist auch auf die Renaissance der sogenannten Doku-Fiktion bzw. des Doku-Dramas zurückzuführen.
Und immer häufiger wollen Journalisten zugleich auch Schriftsteller sein. Ihre Ambitionen sind gross, aber kaum jemand ist ein Fontane oder Heine, die meisten bleiben nur Kurbjuweit oder Weidermann. Aber ihr Renommee als Journalist und die Verankerung im Betrieb verschaffen ihnen für ihre mittelmässigen Produkte die notwendige Aufmerksamkeit.
Die zunehmende Infiltration des Journalismus durch fiktionale Elemente ist auch auf die Renaissance der sogenannten Doku-Fiktion bzw. des Doku-Dramas zurückzuführen. Insbesondere in audiovisuellen Medien erfreut sich dieses Genre zunehmender Beliebtheit. Hier werden historische Bezüge mit fiktionalen Elementen vermischt. Erfundene Figuren treten in Interaktion mit geschichtlichen Persönlichkeiten. So werden dramaturgisch aufbereitete Inszenierungen erstellt, die Historizität suggerieren. Das ist mehr als blosse Kulissenschieberei. Werden die historischen Fakten nicht eindeutig von den fiktionalen Erfindungen bzw. Ergänzungen getrennt (beispielsweise im Film durch entsprechende Kennzeichnungen), ist es dem Rezipienten irgendwann nicht mehr möglich zwischen Wahrheit und Dichtung zu unterscheiden. Derart konditioniert, können sich Legenden, im ungünstigsten Fall Verzerrungen festsetzen.
Als Doku-Drama vermehrt im Fernsehen eingesetzt, ist es auch in der Literatur ein sehr altes und beliebtes Instrument. Die vier Evangelisten sind Dokumentar-Fiktionäre par excellence. Grosssartige Autoren wie William Shakespeare, Friedrich Schiller oder Georg Büchner haben in ihren Theaterstücken realen Personen Monologe, Dialoge und Handlungen «angedichtet». Im Fall von Schiller führte dies sogar zum Nationalmythos der Schweiz. Dennoch wäre niemand auf die Idee gekommen, die Stücke für historisch-dokumentarisch zu halten.
Naturalismus ergänzt mit einem irgendwie aktuellen Zeitbezug ist das Gebot der Stunde. Der Reporter vereinigt beides: Literatentum und Authentizität.
Inzwischen verschwimmen die Grenzen ausgerechnet dort, wo «Authentizität», die Übereinstimmung zwischen Leben und Werk eines Verfassers, längst zum Fetisch des Feuilletons geworden ist. Literaten werden mit ihren Erzählungen und Romanen an der Wirklichkeit gemessen. Naturalismus ergänzt mit einem irgendwie aktuellen Zeitbezug ist das Gebot der Stunde. Der Reporter vereinigt beides: Literatentum und Authentizität. Er wird zum Schöpfer wie die Regisseure von Doku-Dramen zu Dichtern werden.
Und so wundert es kaum, dass Schriftsteller, die ihren politischen Aktivismus nicht mehr vom Werk trennen wollen, in die selbstaufgestellte Falle laufen. Sie, die Moralprediger, empfinden kein Problem mehr mit dem Fälschen eines Zitats. Was für den Roman (das Doku-Drama) noch erlaubt ist, wird auch in die Essayistik transportiert. Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse, ein engagierter Verfechter eines Europastaates, bekennt denn auch, Zitate des ersten Vorsitzenden der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (von 1958-1967), Walter Hallstein, gefälscht zu haben. So hat Hallstein die Aussage «Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee!» nie getroffen, aber Menasse glaubt, dies aus Hallsteins Äusserungen destillieren zu können. Er hätte es so sagen können, lautet die unlautere Ausflucht. «Was kümmert mich das Wörtliche», sagt der Mann des Wörtlichen dann auch.
Die intellektuelle Redlichkeit scheint mit der «richtigen» Gesinnung unwichtig zu werden; Moral gilt nur für den Anderen.
Georg Krieghofer sammelt nicht nur falsche Zitate, er kommentiert sie auch. Menasse hatte er schon im Oktober 2017 enttarnt, weil er seinerseits auf den Historiker Heinrich-August Winkler rekurrierte. Aber erst als ein Journalist der «Welt» tätig wurde, reagierte Menasse und die Öffentlichkeit. Der Aufschrei ob dieser Lüge hielt sich freilich in Grenzen, ist doch Menasse (wie Relotius) preisüberschüttet und man mag gar nicht daran denken, wie eine Demontage dieses lebenden Denkmals aussehen würde. Hallstein kenne doch längst niemand mehr, hält mir jemand auf Twitter vor, es sei demzufolge «wurscht», was dieser gesagt habe. So erhält man sich das wohlige Gefühl in seiner Filterblase. Die intellektuelle Redlichkeit scheint mit der «richtigen» Gesinnung unwichtig zu werden; Moral gilt nur für den Anderen.
Auch die Politwissenschaftlerin und bekennende EU-Lobbyistin Ulrike Guérot (gerne Gast in öffentlich-rechtlichen Talkshows, wenn es um die Zukunft der EU geht) bog Zitate von Hallstein für ihre «Argumentation» zurecht. Unrecht wird durch den vermeintlich guten Zweck zu Recht.
Wen dies stört, gilt als Spielverderber, im schlimmsten Fall «rechts», mindestens aber «umstritten». Nur nichts gegen die «Enthüller», wie beispielsweise Michael Wolff, der Anfang 2018 ein Buch um Donald Trump publizierte und gefeiert wurde – trotz Wolffs «eher entspannte[m] Verhältnis zur Wahrheit» (Tagesspiegel). Auch da war es irgendwann gleichgültig, ob der Autor jemals Belege für seine Zitate beibringen konnte – Hauptsache die Richtung stimmt.
Man begreift sich als Welterklärer, Durchblicker, besserer Politiker. Der Rezipient wird, wenn er nicht gerade pädagogisch betreut wird, eingelullt.
Beflügelt werden die saloppen Auslegungen durch den Wunsch nicht nur von Politikern nach einem «Narrativ», beispielsweise für das Schmackhaftmachen der als müde und abgehoben wahrgenommenen Europäischen Union. Man brauche wieder eine «Erzählung», andere reden gar von «Vision». Das ist der Wunsch nach einem Mythos, der die eigene (politische) Position nicht nur erklären sondern legitimieren soll.
Journalisten sind längst Teil dieser Mythenfabriken. Von der Leitmaxime des «Spiegel», kreiert vom Gründer Rudolf Augstein, «Sagen, was ist», hat man sich nicht nur beim Hamburger Magazin weit entfernt. Man begreift sich als Welterklärer, Durchblicker, besserer Politiker. Der Rezipient wird, wenn er nicht gerade pädagogisch betreut wird, eingelullt. Aus «Sagen, was ist» wird ein sakrosanktes «Wir sagen, was ist».
Inzwischen sorgen sich einige um das Seelenheil des Fälschers. Sie sehen die Gründe für Relotius‘ Fehlverhalten entweder im ökonomischen Druck (das ist gerade beim «Spiegel» lächerlich) oder in von aussen herangetragenen Erwartungshaltungen. Immerhin blieb die veritable Publikumsbeschimpfung noch aus. Andere befürchten, dass der Skandal den «falschen Leuten» als Argumentationshilfe dient. Wieder einmal blicken Journalisten auf die Aussenwirkung – sie können nicht anders. Dass genau hierin die Ursache liegen könnte, kommt ihnen nicht in den Sinn: Es sind gerade diese Eitelkeiten, die Selbstdarstellung als «Qualitätsmedien», die dem Rezipienten immer mehr übel aufstossen. Zu oft wurden sie getäuscht, mit einseitigen und tendenziösen Informationen abgespeist. Erst später gab es die ein oder andere halbherzige Aufklärung.
So wird es auch heute sein. Die Karawane wird nach einigem Lamentieren weiterziehen. Das kennt man von ähnlichen Fällen. Schon liest man trotzige Gewissheiten; Reflexionsfähigkeit und Demut bleiben Fremdworte. Man wundert sich nur noch darüber, dass sich Journalisten darüber wundern, dass man ihnen nicht mehr glaubt.



Frank Hofmann 09. Januar 2019, 17:02
Exzellenter Artikel, der die Fehlentwicklungen beim Namen nennt. Chapeau!