Übersetzungsautomaten statt Sprachbarrieren
Dank den Fortschritten künstlicher Intelligenz können Medienbeiträge ohne grossen Aufwand in andere Sprachen übersetzt werden. So wird der Medienmarkt auch auf der Ebene der Inhalte ein globaler. Die weitgehend automatisierten Prozesse erfordern eine eigene Übersetzungsethik.
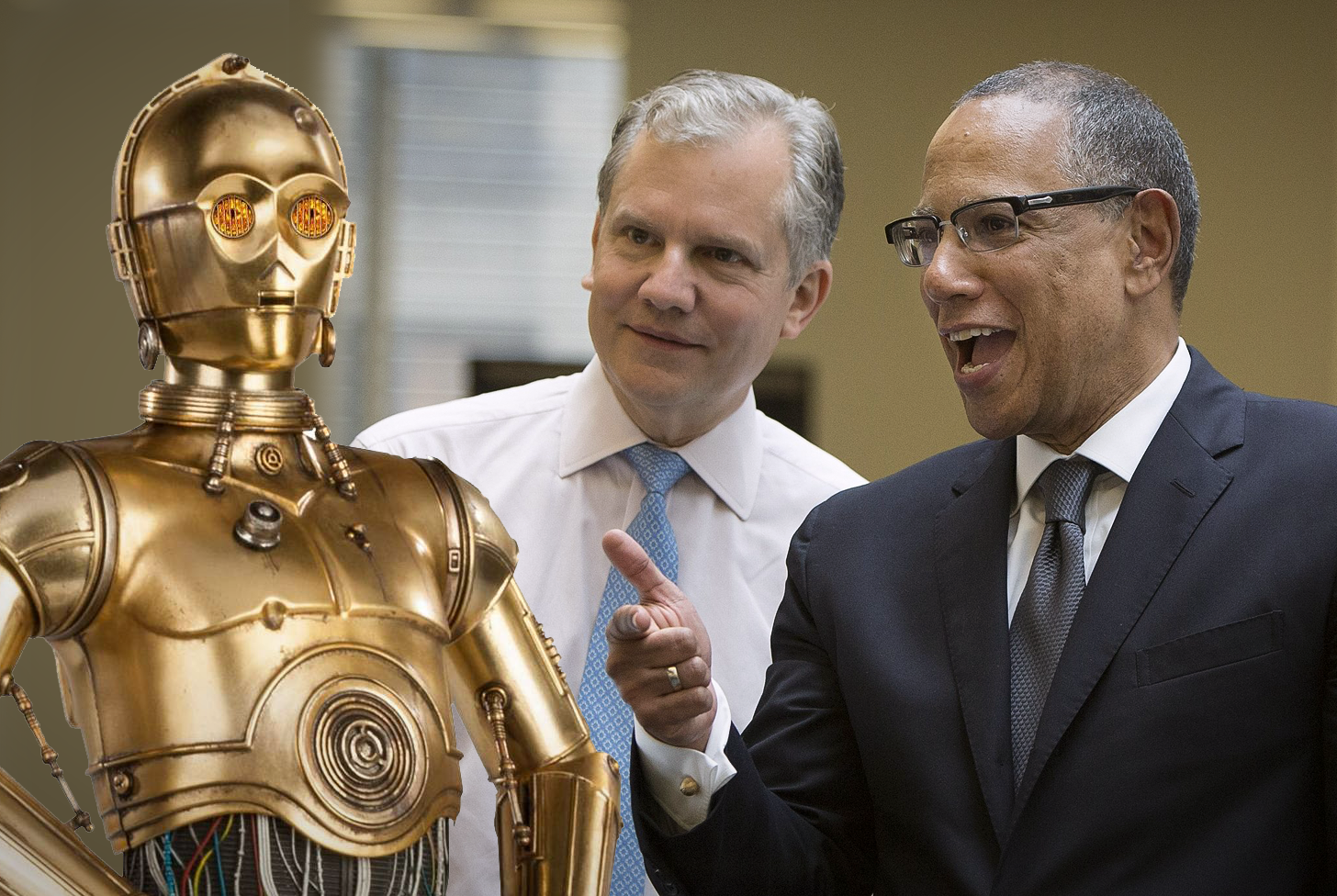
Das Mediengeschäft war schon immer ein globales und polyphones. BBC World News etwa strahlt Inhalte in über 40 Sprachen aus – von Aseri bis Swahili. Das Portal swissinfo.ch bitet Informationen in zehn Sprachen. Und die Deutsche Welle sendet ihr Programm neben Deutsch auch auf Englisch, Spanisch und Arabisch. Dass ein Medium in verschiedenen Sprachen erscheint, war in der Vergangenheit den öffentlich-rechtlichen Sendern vorbehalten. Längst aber bieten auch Zeitungen und Online-Medien ihre Beiträge mehrsprachig an.
So gibt es seit 2012 gibt es eine chinesisch-sprachige Ausgabe der NYT, 2016 folgte im Rahmen der Expansionspläne eine spanische Ausgabe, um vor allem die wachsende Zahl der Hispanics zu adressieren. Wie die NYT hat auch das «Handelsblatt» eine globale englischsprachige Ausgabe («Handelsblatt Global Edition») Die NZZ hatte Ende der 1990er Jahre ebenfalls eine digitale englischsprachige Ausgabe in Form eines «English Window» auf der Website, die sich aber nicht etablieren konnte. Seitdem publiziert die NZZ in loser Folge Beiträge auf Englisch, für die sie ein entsprechendes internationales Publikumsinteresse vermuten.
Sprachbarrieren sind längst keine Hürde mehr für einen Markteintritt.
In den letzten Jahren konnte man vor allem eine internationale Strategie bei den grossen US-Medien-Startups beobachten: «Vice» berichtet seit 2005 auch auf Deutsch, auch aus der Schweiz, «BuzzFeed» zählt mittlerweile zehn internationale Ausgaben (darunter Deutschland, Australien und Brasilien), die «Huffington Post» ist neben den USA und Kanada in 13 weiteren Ländern präsent. Gleichzeitig publizieren europäische, nicht-englischsprachige Medien wie «Spiegel Online», «Zeit Online» oder die spanische Sportzeitung «La Marca» zunehmend Artikel auf Englisch, um eine globale Leserschaft zu erreichen. Sprachbarrieren sind längst keine Hürde mehr für einen Markteintritt. Es ist vor allem der technologische Wandel, der hier Wände einreisst.
Der bekannte britische Journalist Simon Kuper hat in seiner Kolumne in der «Financial Times» unlängst eine interessante These aufgestellt: Durch die Fortschritte künstlicher Intelligenz werden die bisherigen globalen Leitmedien aus den USA und aus Grossbritannien (NYT, WSJ, FT, Economist) ihre Dominanz in der Medienlandschaft verlieren. Kuper glaubt: «In ein paar Jahren werden Spitzen-Zeitungen wie ‹Die Zeit› ihre deutsche Ausgabe produzieren, dann auf ‹Übersetzen› drücken und im Nu eine sehr ordentliche englische Version bekommen. Stellen Sie ein paar englischsprachige Redakteure ein, die an den maschinellen Sätzen etwas feilen, und schon konkurrieren Sie mit der ‹New York Times›.»
Eine grössere Reichweite hilft auch neues kommerzielles Potenzial zu erschliessen.
Bislang war es so, dass News-Portale wie «Zeit Online» ausgewählte Artikel von Übersetzern ins Englische übertragen. Das kostet Geld, und die Resonanz der Beiträge (manche Artikel wurden lediglich ein paar Mal auf Twitter geteilt) war jetzt auch nicht so, als würden sie der NYT das Fürchten lehren. Gelänge es aber, die komplette Ausgabe der Zeit durch eine KI-Software ins Englische zu übersetzen, hätte man ein Produkt, das es durchaus mit der NYT aufnehmen könnte. Eine europäische Aussensicht auf die Ereignisse in der Welt wäre sicher auch für US-Leser, die keine Deutschkenntnisse haben, von Interesse. Ausserdem würde eine grössere Reichweite auch neues kommerzielles Potenzial zu erschliessen helfen. Die SRG könne ohne grossen Personalaufwand Inhalte in dutzenden Sprachen senden und auf einen Schlag die BBC konkurrenzieren. Als erste Testumgebung dafür bieten sich indes die Schweizer Landesteile an. Hier kann der vermehrte Einsatz von Übersetzungssoftware helfen, die Programme von SRF, RTS und RSI einander näher zu bringen.
Wolfgang Blau, Präsident des internationalen Verlagshauses Condé Nast, hält maschinelle Übersetzung für eine grosse Chance für Europa. «Egal ob in Kroatien oder Österreich: Gäbe es die Möglichkeit, alle Produktbeschreibungen eines E-Commerce-Unternehmens oder zum Beispiel auch journalistische Inhalte sofort in alle Sprachen Europas automatisch zu übersetzen, würde das ganz neue Möglichkeiten eröffnen und auch der Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit helfen», sagte er dem «Standard». Wobei das natürlich keine Einbahnstrasse wäre. Genau so könnten auch US-Medien wie NYT oder das WSJ maschinell eine deutschsprachige Version produzieren. Die NYT geniesst gerade in bürgerlichen Kreisen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine hohe Reputation. Eine deutschsprachige Ausgabe der NYT könnte etablierten Medien wie der Zeit, FAZ oder NZZ Marktanteile abringen. Wobei die Chance, den umkämpften US-Markt zu erobern, geringer sein dürfte als das Risiko, von einer globalen Marke wie der NYT oder FT konkurriert zu werden. Die NYT könnte sich einzelne Korrespondenten sparen, wenn sie auf lokale Berichterstattung von Partnermedien zurückgreifen könnte.
Insofern schafft Google hier zwar eine Plattform für Verlage, aber gleichzeitig auch einen neuen Flaschenhals.
Die Frage ist nur, wer diese Übersetzungsdienste anbietet – die Medienunternehmen selbst oder Technologiekonzerne? Google hat gerade angekündigt, eine sprachgesteuerte Version seines Dienstes «Google News» für Smart Speaker und Smartphones zu lancieren. Laut einem Bericht des Nieman Lab hat Google in Zusammenarbeit mit rund 130 Verlagen den Prototypen eines «Radiosenders» entwickelt, den Nutzer per Sprachsteuerung bedienen können («Hey Google, next Story»). Medienhäuser könnten hier übersetzte Podcasts einspeisen. Welche Meldung Google auswählt und als erste vorschlägt, unterliegt den intransparenten Algorithmen des Unternehmens. Insofern schafft Google hier zwar eine Plattform für Verlage, aber gleichzeitig auch einen neuen Flaschenhals, dessen Durchlässigkeit Google nach eigenen Gesetzmässigkeiten reguliert.
Die Qualität von Übersetzungsprogrammen hängt massgeblich von der Qualität der Daten ab. Je mehr Daten das System verarbeitet, desto präziser werden die Ergebnisse. Und hier ist Google führend. Wer die jüngst in der NYT erschienene Reportage über La Chaux-de-Fonds in Google Translate eingibt, erhält eine recht passable Übersetzung des Texts auf Deutsch. Laut Google-Chef Sundar Pichai übersetzt die App täglich 143 Milliarden (!) Wörter. Das ist fast zweihunderttausend Mal die Bibel (Umfang: 738.765 Wörter). Eine Textmenge babylonischen Ausmasses. Erzeugten Übersetzungsprogramme vor einigen Jahren noch einen jämmerlichen Textverhau mit holprigen Sätzen, liefern sie heute grammatikalisch korrekte Sätze.
Um ihre Texte zu übersetzen, müssen Medienhäuser womöglich auf die Tools von Google zurückgreifen. Das würde die ohnehin schon grosse Abhängigkeit von Medienunternehmen (durch News-Aggregatoren und Journalismusfonds) weiter erhöhen. Information, Produktion, Vertrieb – Google könnte die zentralen Glieder der journalistischen Verwertungskette besetzen und zu einer Art Superverleger mutieren. Alternativ böte sich der Übersetzungsdienst des Kölner Start-ups Deepl (früher Linguee) an, der viel Lob von Linguisten erhielt, dem aber der Deutsche Verband der freien Übersetzer und Dolmetscher (DVÜD) noch einige technische Unzulänglichkeiten attestierte (allerdings war der Text-Text, eine Betriebsanleitung, auch sehr technisch). An Google wird wohl kein Weg vorbeiführen.
Es geht dabei nicht um Stilkritik, sondern um die Deutungshoheit über Begrifflichkeiten.
Die Gefahr dabei ist, dass der Internetkonzern nicht nur die Verbreitung von Inhalten kontrolliert (wer sieht welche Artikel?), sondern dass dem Konzern auch eine Sprachmacht zuwächst, indem seine Algorithmen Auslegungsregeln für Übersetzungen festzurren. Es geht dabei nicht um Stilkritik, sondern um die Deutungshoheit über Begrifflichkeiten. Ob man die Ausschreitungen in Chemnitz als einen «wütenden Mob» (angry mob, so die NYT) oder «Hetzjagd» bezeichnet, macht in der politischen Bewertung der Vorkommnisse einen erheblichen Unterschied.
Wie hätte eine Übersetzungssoftware einen Artikel der NTY oder «Zeit» übersetzt? Wäre die Software so intelligent, heikle oder nicht belegbare Begriffe in Anführungszeichen zu setzen? Oder würde durch die Artikel so etwas die Normativität des Faktischen greifen und sich Begriffe schon allein deshalb etablieren, weil sie tausendfach geteilt wurden? Schon der Schwarmintelligenz menschlicher Berichterstatter unterlaufen bisweilen fatale Übersetzungsfehler. So wurde Trumps Aussage, die Nato sei «obsolet», wörtlich mit «obsolet» ins Deutsche übersetzt, wobei das englische Adjektiv «obsolet» eher «aus der Zeit gefallen» oder «veraltet» meint. Automatische Übersetzung droht zu einem nichtlegitimierten Sprachinstanz zu werden, die klammheimlich Sprechweisen und Sagbares definiert. Es bräuchte daher für maschinelles Übersetzen genauso eine Ethik wie für automatisierten Journalismus.
Ein Algorithmus könnte definitiv billiger und effektiver Artikel selektieren und übersetzen.
Die Frage ist auch, was mit Zeitschriften wie «Courrier international» (Frankreich) oder Internazionale (Italien) passiert, deren Kerngeschäft darin besteht, Artikel aus der ausländischen Presse ins Französische bzw. Italienische zu übersetzen. Werden sie durch die Fortschritte von künstlicher Intelligenz überflüssig? Ein Algorithmus könnte definitiv billiger und effektiver Artikel selektieren und übersetzen. Das britische Marketing-Magazin «The Drum» hat IBMs Superrechner Watson bereits eine ganze Heftausgabe editieren lassen.
Am Ende ist die Entwicklung ambivalent: Die Fortschritte von KI-Übersetzungsprogrammen bieten die Chance, durch Artikel aus der Auslandspresse die Medienlandschaft zu weiten und dem Trend der Medienkonzentration entgegenzuwirken. Sie bergen aber auch das Risiko, dass Content noch mehr als heute schon zum Datenfutter für Maschinen verkommt und die Abhängigkeit von Verlagen zu Tech-Konzernen wie Google oder Facebook weiter zunimmt.


