Nach Jahren des Stillstands will der Bundesrat Social Media regulieren
Lieber spät als nie: Jetzt sieht der Bundesrat doch noch die Notwendigkeit, Plattformen wie Facebook oder Youtube stärker in die Pflicht zu nehmen. Wie das genau geschehen soll, bleibt vorerst noch offen. Eine «breite Debatte» soll die Stossrichtung klären. In den USA und in der EU gibt es derweil schon konkrete Vorschläge für die Plattformregulierung.
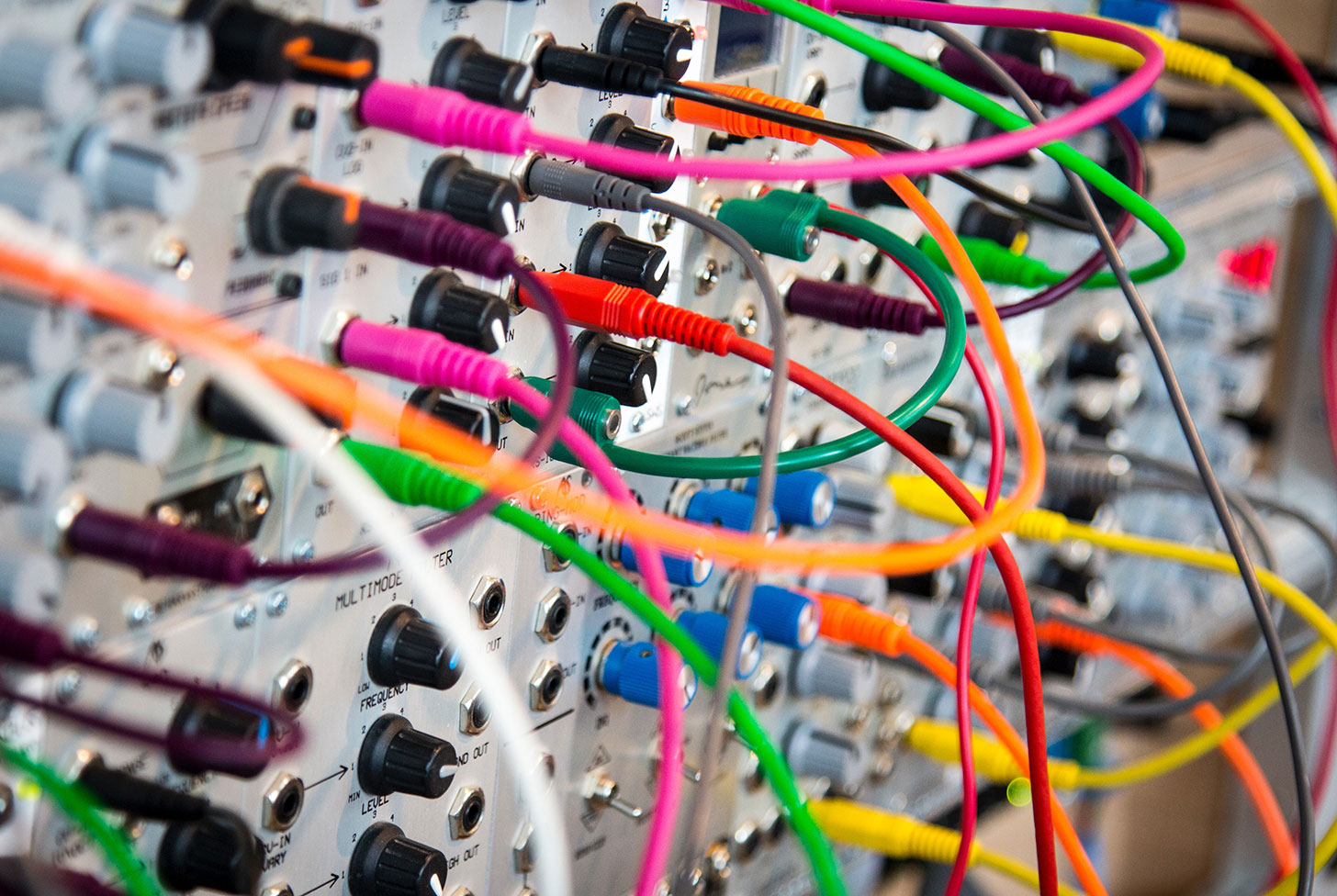
Bis 2014 lautete das interne Motto von Facebook: «Move Fast and Break Things», auf Deutsch «Beweg dich schnell und mach dabei Dinge kaputt». Ein Hacker-Ethos, der besagt, Neues auszuprobieren und Risiken einzugehen sei besser als allzu vorsichtig vorzugehen. Im Nachhinein um Vergebung zu bitten ist schliesslich einfacher, als vorab um Erlaubnis zu fragen.
In der Coronavirus-Pandemie wird überdeutlich, dass Social-Media-Plattformen regelrechte Inkubatoren für Falschinformation aller Art sind.
«Move Fast and Break Things» ist auch eine passende Beschreibung für die Social-Media- und Internet-Industrie im Allgemeinen. In den letzten rund 20 Jahren haben Tech-Unternehmen viel bewegt und dabei auch viel zerbrochen. Was genau, beschreibt der Bericht «Intermediäre und Kommunikationsplattformen». Das im Auftrag des Bakom erstellte Dokument identifiziert drei zentrale Probleme im Zusammenhang mit Social Media: Falschinformation, Hassrede und Intransparenz.
In der Coronavirus-Pandemie wird überdeutlich, dass Social-Media-Plattformen regelrechte Inkubatoren für Falschinformation aller Art sind. Gerüchte, Halbwahrheiten, Verschwörungstheorien, aber auch gezielt gestreute Desinformation verbreiten sich heute dank des Plattform-Ökosystems so schnell und ungehindert wie noch nie. Die Plattformen sind auch Orte, wo sich Individuen und Gruppen enthemmt der Hassrede hingeben, die von Hasskampagnen über «Bullying» bis hin zu direkten Gewalt- und Todesdrohungen reicht. Bei alledem bleiben Facebook oder Youtube eine intransparente Blackbox. Wir wissen nicht, wie genau ihre Algorithmen operieren. Als Nutzer*innen sind wir nicht selten willkürlichen Eingriffen wie Kontosperrungen ohne Rekursmöglichkeit ausgeliefert, die uns de facto von der digitalen Öffentlichkeit ausschliessen.
Das angekündigte Vorgehen markiert eine klare Kehrtwende zur bisherigen Laissez-faire-Politik des Bundesrats.
Darum will nun der Bundesrat, gestützt auf den Bakom-Bericht, eine «breite Diskussion» anstossen. Wie das genau geschehen und gelingen soll, lässt er offen. Klar ist indes: Bis Ende 2022 soll das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Uvek in einem weiteren Bericht aufzeigen, ob und wie die Plattformen in der Schweiz reguliert werden könnten. Dieser Bericht dürfte im Parlament und in den journalistischen Medien für Diskussionen Sorgen.
Unterstützen Sie unabhängigen und kritischen Medienjournalismus. Werden Sie jetzt Gönner/in.
Journalismus braucht Herzblut, Zeit – und Geld. Mit einem Gönner-Abo helfen Sie, unseren unabhängigen Medienjournalismus nachhaltig zu finanzieren. Ihr Beitrag fliesst ausschliesslich in die redaktionelle und journalistische Arbeit der MEDIENWOCHE.
All dies mag auf den ersten Blick nach einem bürokratischen Papiertiger aussehen: Auf einen Bericht folgt der Entscheid, einen weiteren Bericht zu erstellen. Doch das angekündigte Vorgehen markiert eine klare Kehrtwende zur bisherigen Laissez-faire-Politik. Noch 2017, nach einer von der heutigen Bundes- und damaligen Nationalrätin Viola Amherd bereits 2011 angestossenen4 Debatte, sah der Bundesrat keinen Handlungsbedarf. Was hat den Bundesrat nach zehn Jahren Passivität in Sachen Plattformregulierung zum Handeln bewegt?
In den vergangenen Jahren in den USA und in der EU eine Regulierungsdebatte Fahrt aufgenommen, die dazu beigetragen hat, dass der Bundesrat nun doch aktiv wird.
Einerseits hat der Leidensdruck in den letzten vier Jahren zugenommen. Die Probleme der Plattformen akzentuierten sich in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt durch Donald Trumps Amtszeit und der damit verbundenen Online-Radikalisierung. So verbreitete sich etwa der 2017 entstandene Verschwörungskult QAnon rasant und weltumspannend über Social Media und wurde damit zum bis heute fruchtbaren Nährboden für Falschinformationen und Verschwörungslügen aller Art. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich die Situation nochmals merklich verschärft, wodurch auch das politische Bewusstsein für die prekäre Lage stieg. Andererseits hat in den vergangenen Jahren in den USA und in der EU eine Regulierungsdebatte Fahrt aufgenommen, die dazu beigetragen hat, dass der Bundesrat nun doch aktiv wird.
Dass ausgerechnet in den USA eine Debatte zur Regulierung der Tech-Giganten stattfindet, mag auf den ersten Blick überraschen. Schliesslich sind die USA die Heimat von Mega-Konzernen wie Google, Meta (ehemals Facebook), Microsoft, Amazon. Jahrzehntelang galt jede Regulierungsbestrebung als Tabu und die Internet-Giganten konnten die uneingeschränkten Freiheiten des Markts geniessen. Die Unantastbarkeit der Plattformen ist gesetzlich verankert. Der «Internet Communications Decency Act» von 1996, das wichtigste Gesetz zur Internetregulierung, besagt in Abschnitt 230, dass Plattformbetreiber für Inhalte, die Dritte veröffentlichen, grundsätzlich in keiner Art haften müssen. Darüber herrschte jahrzehntelang parteiübergreifend Konsens. Manche argumentieren gar, es sei dieser Blankoscheck, der die Tech-Industrie überhaupt gross gemacht habe. Doch der politische Wind hat in Washington gedreht, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Konservative Politiker*innen der republikanischen Partei nehmen «Big Tech» ins Visier, weil sie glauben, dass die Plattformbetreiber rechtskonservative Stimmen und Ansichten etwa durch die Löschung rechtsextremer Konten und Gruppen unterdrückten. Mitglieder der demokratischen Partei wiederum sehen «Big Tech» seit der herben Wahlniederlage 2016 als Risiko für die demokratische Meinungsbildung und als gefährliches Werkzeug für politische Manipulation. In welche Richtung sich die bis anhin noch diffuse amerikanische Regulierungsdebatte entwickelt, ist gegenwärtig noch unklar. Doch allein der Umstand, dass eine solche Debatte in den USA überhaupt stattfindet, zeugt von einem bedeutenden politischen Stimmungswandel in der Heimat der grossen Plattformen.
Reicht ein Blick in die USA und die EU wirklich, um aufzuzeigen, wie Social-Media-Plattformen nachhaltig reguliert werden können? Wahrscheinlich nicht.
In der Europäischen Union ist, wie der Bakom-Bericht festhält, die Regulierungsdebatte schon konkreter und weiter fortgeschritten. Als wichtigster Treiber auf EU-Ebene wirkt der Ende 2020 von der EU-Kommission verabschiedete Entwurf des «Digital Services Act», auf Deutsch «Vorschlag für ein Gesetz über digitale Dienste». Dieser Gesetzesvorschlag soll in erste Linie den Umgang mit illegalen Inhalten regeln. Zwar sollen Plattformbetreiber für die Inhalte ihrer User, analog zum Prinzip der Section 230 in den USA, auch in Zukunft nicht haften. Werden aber illegale Inhalte veröffentlicht, sollen die Plattformbetreiber schneller und kooperativer einschreiten müssen, den Content moderieren oder entfernen und allfällige strafrechtlich relevante Inhalte den Justizbehörden melden. Darüber hinaus will der «Digital Services Act» die Plattformen dazu verpflichten über Werbung und Empfehlungs-Algorithmen mehr Transparenz zu schaffen. Ausserdem sollen sie ihre Daten für unabhängige wissenschaftliche Forschung einfacher zugänglich machen. So könnte zum Beispiel das wahre Ausmass an Hassrede auf Social Media gemessen werden.
Vor diesen Hintergrund kommt der Bakom-Bericht zum Schluss, dass eine breite Debatte über die Regulierung der grossen Plattformen angesichts ihrer heute nicht mehr zu leugnenden negativen Auswirkungen überfällig sei in der Schweiz. Die Regulierungsbemühungen in den USA und in der EU sollen dabei unsere Vorstellungskraft stimulieren und aufzeigen, was möglich ist.
Doch reicht ein Blick in die USA und die EU wirklich, um aufzuzeigen, wie Social-Media-Plattformen nachhaltig reguliert werden können? Wahrscheinlich nicht. Die laufenden Debatten im Ausland gehen eher in Richtung Symptombekämpfung. Das zentrale Problem wird nicht angetastet: Der fundamentale Widerspruch zwischen der profitorientierten Logik privater Tech-Konzerne und der gemeinwohlorientierten Logik demokratischer Gesellschaften.
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass die Plattformbetreiber der Verantwortung, die sie mit ihrer quasi-demokratischen Funktion haben, nicht nachkommen.
Plattformbetreiber stellen, wie auch im Bakom-Bericht festgehalten wird, nicht irgendwelche Produkte und Dienstleistungen bereit, es geht nicht um Turnschuhe oder Kaugummi. Ihr Geschäft ist inzwischen untrennbar mit zentralen Funktionen moderner Demokratie verwoben – die grossen Plattformen bilden heute de facto die digitale Infrastruktur demokratischer Öffentlichkeiten. Und es ist eben genau diese quasi-demokratische Rolle, die es den Plattformen überhaupt ermöglicht, gross zu werden und so lukrativ zu geschäften wie sie es tun. Der unlängst zu «Meta» umgetaufte Facebook-Konzern erwirtschaftete alleine im Jahr 2020 rund 30 Milliarden Dollar Gewinn. Milliarden von Usern weltweit nutzen Plattformen, um aktiv oder passiv am öffentlichen Diskurs teilzunehmen, um sich zu informieren und diskutieren.
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat aber überdeutlich aufgezeigt, dass die Plattformbetreiber der Verantwortung, die sie mit ihrer quasi-demokratischen Funktion haben, nicht nachkommen, sondern sich in erster Linie vom Profitstreben leiten lassen. All die Probleme, mit denen wir heute zu kämpfen haben – Falschinformation, Hassrede, Intransparenz – sind nicht Unfälle oder Zufälle, sondern zentrale Pfeiler in der Architektur der Plattformökonomie. Oder, in Techjargon: It’s not a bug, it’s a feature. Es ist kein Fehler im Computercode, es ist eine bewusst implementierte Eigenschaft.
Es bleibt zu hoffen, dass der Bundesrat auch den Mut findet, nicht bloss existierende ausländische Regulierungs-Vorschläge wiederzugeben.
Um diesen fundamentalen Widerspruch zwischen kommerziellen Interessen und gesunder Demokratie zu überwinden, sind regulatorische Visionen nötig, die über die aktuellen Debatten in den USA und der EU hinausgehen. Plattformen werden dann – und nur dann – wirklich kompatibel mit der Demokratie, wenn sie demokratisch legitimiert werden. Eine solche demokratische Legitimierung kann beispielsweise durch entsprechende Kontroll- und Aufsichtsorgane erfolgen, die über bestehende PR-Feigenblätter wie Facebooks «Oversight Board» hinausgehen. Aber auch bestimmte Formen der Vergesellschaftung sind denkbar. Wenn Plattformen als demokratische Infrastruktur dienen und nur deshalb überhaupt erst ihr Geschäft betreiben können, kann es angebracht sein, sie entsprechend zu regulieren. Zum Beispiel, indem sie genossenschaftlich anstatt rein privatwirtschaftlich (mit steueroptimiertem Sitz in Übersee) organisiert werden.
Darüber eine breite Diskussion anstossen zu wollen, ist richtig und wichtig. Es bleibt zu hoffen, dass der Bundesrat auch den Mut findet, nicht bloss existierende ausländische Regulierungs-Vorschläge wiederzugeben, sondern echte Visionen zu formulieren, mit denen die Schweiz eine weltweite Pionierrolle in Fragen der digitalen Demokratie einnimmt. Mit der Regulierung der Plattformen zugunsten funktionierender Demokratie verhält es sich nämlich ähnlich wie mit Golf: Wer den Ball zu kurz spielt, verfehlt das Loch garantiert.
Bild: John Barkiple on Unsplash
